SGB XI: Pflegeversicherung vorherige Versionen anzeigen
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 1 – SGB XI, 23. Lfg. V/05 |
SGB XI C 461
AOK-Bundesverband, Bonn
Bundesverband der Betriebskrankenkassen, Essen
IKK-Bundesverband, Bergisch Gladbach
See-Krankenkasse, Hamburg
Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Kassel
Bundesknappschaft, Bochum
AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V., Siegburg
Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V., Siegburg
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V., St. Augustin
Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften e. V., Kassel
Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e. V., München
Verband deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin
Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg
20. Oktober 1994
Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit
(Pflege-Versicherungsgesetz – PflegeVG);
hier: Versicherungs-, Melde- und Beitragsrecht1)
Am 28. Mai 1994 ist das Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz – PflegeVG) im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1014 verkündet worden. Es trägt das Datum vom 26. 5. 1994. Die soziale Pflegeversicherung wird vom 1. 1. 1995 an die fünfte Säule der Sozialversicherung bilden und als Elftes Buch in das Sozialgesetzbuch eingestellt. Sie sieht vom 1. 1. 1995 an Leistungen für die häusliche Pflege und vom 1. 7. 1996 an Leistun-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 2 – SGB XI, 23. Lfg. V/05 |
gen bei stationärer Pflege vor. Träger der sozialen Pflegeversicherung sind die Pflegekassen, die bei jeder gesetzlichen Krankenkasse errichtet werden.
Die Pflegeversicherung orientiert sich an dem Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“. In die soziale Pflegeversicherung werden grundsätzlich alle Personen einbezogen, die der gesetzlichen Krankenversicherung angehören. Alle privat krankenversicherten Personen werden verpflichtet, bei ihrem privaten Krankenversicherungsunternehmen zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit einen Versicherungsvertrag abzuschließen und aufrecht zu erhalten.
Die Mittel für die Pflegeversicherung werden durch Beiträge sowie sonstige Einnahmen gedeckt. Dabei erfolgt die Finanzierung im so genannten Umlageverfahren, d. h., die benötigten Mittel werden jeweils durch die laufenden Einnahmen aufgebracht. Der Beitragssatz beträgt vom 1. 1. 1995 bis zum 30. 6. 1996 1 v. H. Mit dem In-Kraft-Treten der zweiten Stufe der Pflegeversicherung am 1. 7. 1996 erhöht sich der Beitragssatz auf 1,7 v. H.
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben in mehreren Besprechungen über die versicherungs-, melde- und beitragsrechtlichen Vorschriften des Pflege-Versicherungsgesetzes beraten. Die dabei erzielten Ergebnisse sind in diesem Rundschreiben zusammengefasst. Den Erläuterungen ist jeweils der Gesetzestext vorangestellt.
Die Deutsche Verbindungsstelle – Krankenversicherung Ausland – wird zur Pflegeversicherung mit Auslandsbezug gesondert in einem Rundschreiben Stellung nehmen.
A Versicherter Personenkreis
I Grundsatz der Pflegeversicherung
Der versicherte Personenkreis in der Pflegeversicherung richtet sich nach dem Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ (vgl. Bundestags-Drucksache 12/5952 S. 3). In die soziale Pflegeversicherung werden daher grundsätzlich alle Personen einbezogen, die der gesetzlichen Krankenversicherung als Mitglied angehören. Alle privaten Krankenversicherten werden verpflichtet, einen adäquaten privaten Pflegeversicherungsschutz bei einem privaten Versicherungsunternehmen abzuschließen (vgl. § 1 Abs. 2 SGB XI).
II Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung
1 Allgemeines
Die Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung erstreckt sich auf alle Personen, die Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Dabei ist es unerheblich, ob die Mitgliedschaft in der Krankenversicherung auf einer Pflichtversicherung oder auf einer freiwilligen Versicherung beruht.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 3 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Darüber hinaus werden bestimmte Personengruppen in die Versicherungspflicht der sozialen Pflegeversicherung eingebunden, die weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind und ihre Ansprüche auf Leistungen im Krankheitsfalle aus Sondersystemen herleiten.
2 Versicherungspflicht für Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung
2.1 Allgemeines
Der in § 20 Abs. 1 bis 3 SGB XI beschriebene versicherungspflichtige Personenkreis entspricht dem in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Personenkreis. Dabei wird die Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung an die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung gekoppelt.
Anders als im Krankenversicherungsrecht existieren im Elften Buch Sozialgesetzbuch keine Vorschriften, die die Vor- bzw. Nachrangigkeit einzelner Versicherungspflichttatbestände regeln, wenn bei einem Versicherten gleichzeitig mehrere Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Das Fehlen solcher Konkurrenzregelungen führt jedoch im Ergebnis nicht zu einer Abweichung von dem in der Krankenversicherung versicherten Personenkreis, denn der in der Pflegeversicherung maßgebende Versicherungspflichttatbestand knüpft an den jeweiligen Versicherungspflichttatbestand in der Krankenversicherung an.
2.2 Beschäftigte
Nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 in Verb. mit Satz 1 SGB XI unterliegen die gegen Arbeitsentgelt beschäftigten Arbeiter, Angestellten und Auszubildenden der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung, vorausgesetzt, sie sind aufgrund ihrer Beschäftigung versicherungspflichtige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Damit wird klargestellt, daß Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB XI nicht zustande kommt, wenn in der Beschäftigung Krankenversicherungsfreiheit (§§ 6 und 7 SGB V) besteht.
2.3 Bezieher von Vorruhestandsgeld
Die Bezieher von Vorruhestandsgeld werden – wie im Krankenversicherungsrecht – den gegen Arbeitsentgelt Beschäftigten gleichgestellt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 SGB XI). Das Zustandekommen von Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung hängt also davon ab, daß sie unmittelbar vor Beginn des Vorruhestandsgeldes versicherungspflichtig waren und das Vorruhestandsgeld mindestens in Höhe von 65 v. H. des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne des § 3 Abs. 2 des Vorruhestandsgesetzes gezahlt wird. Das gilt unabhängig davon, daß die Vorschriften des Vorruhestandsgesetzes vom 1. 1. 1989 an grundsätzlich nicht mehr anwendbar sind.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 4 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Sofern Bezieher von Vorruhestandsgeld ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und mit dem ausländischen Staat keine über- oder zwischenstaatlichen Regelungen über Sachleistungen bei Krankheit bestehen, unterliegen sie gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 SGB XI nicht der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung.
2.4 Leistungsempfänger nach dem Arbeitsförderungsgesetz
Nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 in Verb. mit Satz 1 SGB XI werden die Personen der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung unterstellt, die Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosenbeihilfe, Eingliederungsgeld, Eingliederungshilfe, Unterhaltsgeld oder Altersübergangsgeld erhalten. Darüber hinaus werden von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach dieser Vorschrift auch die Personen erfaßt, die Vorruhestandsgeld nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets erhalten.
Versicherungspflicht besteht ferner – wegen der Anlehnung an die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung durch § 20 Abs. 1 Satz 1 SGB XI – für die fünfte bis zwölfte Woche einer Sperrzeit nach § 119 AFG sowie für den Zeitraum, währenddessen der Anspruch nach § 117 a AFG ruht. Für die erste bis vierte Woche einer Sperrzeit nach § 119 AFG tritt Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 in Verb. mit Satz 1 SGB XI nicht ein. Da das Elfte Buch Sozialgesetzbuch allerdings keine nachgehenden Leistungsansprüche kennt, kann es erforderlich sein, diese Zeit mit einer Weiterversicherung nach § 26 Abs. 1 SGB XI zu überbrücken, um einen durchgehenden Leistungsbezug (z. B. für nach § 25 SGB XI versicherte Angehörige) zu gewährleisten oder um Lücken im Versicherungsverlauf zu vermeiden. In § 49 Abs. 2 Satz 2 SGB XI wird die Vorschrift des § 155 Abs. 2 AFG für entsprechend anwendbar erklärt. Das bedeutet, daß das Versicherungsverhältnis in der sozialen Pflegeversicherung grundsätzlich nicht berührt wird, wenn die Entscheidung, die zu dem Leistungsbezug geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die Leistung zurückgefordert oder zurückgezahlt worden ist.
Rückwirkend berührt wird das Versicherungsverhältnis – wie in der Krankenversicherung – allerdings in den Fällen des § 157 Abs. 3 a Satz 2 AFG, wenn die Entscheidung, die zu dem Leistungsbezug geführt hat, rückwirkend aufgehoben und die Leistung zurückgefordert worden ist und für diesen Zeitraum ein weiteres Krankenversicherungsverhältnis
- – bei derselben Krankenkasse bestanden hat,
- – bei einer anderen Krankenkasse bestanden hat, die Krankenkasse, die die Krankenversicherung nach den §§ 155 bis 161 AFG durchgeführt hat, jedoch keine Leistungen der Krankenversicherung erbracht hat.
2.5 Landwirte, mitarbeitende Familienangehörige und Altenteiler
Von der Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI werden die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung pflichtversicherten
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 5 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Personen erfaßt, wenn sie Mitglied der landwirtschaftlichen Krankenkasse sind
- – als landwirtschaftlicher Unternehmer aufgrund der Versicherungspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 KVLG 1989,
- – als mitarbeitender Familienangehöriger aufgrund der Versicherungspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 KVLG 1989,
- – als Altenteiler aufgrund der Versicherungspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 KVLG 1989,
- – als Bezieher von Produktionsaufgaberente oder Ausgleichsgeld nach § 14 Abs. 4 FELEG (vgl. Artikel 10 Nr. 14 ASRG 1995).
Personen, die einen Antrag auf Rente aus der Alterssicherung der Landwirte oder einen Antrag auf Produktionsaufgaberente oder Ausgleichsrente nach dem FELEG gestellt haben und in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung nach § 23 KVLG 1989 versichert sind, gelten als Mitglieder der Pflegekasse (vgl. Ausführungen unter B II 1.4).
2.6 Künstler und Publizisten
Die Vorschrift des § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 in Verb. mit Satz 1 SGB XI entspricht der im Bereich der Krankenversicherung bestehenden Vorschrift des § 5 Abs. 1 Nr. 4 SGB V und unterwirft die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz krankenversicherungspflichtigen selbständigen Künstler und Publizisten der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung.
2.7 Jugendliche, Rehabilitanden, Behinderte
Die in § 20 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 5 bis 8 SGB XI genannten versicherungspflichtigen Personen entsprechen im wesentlichen den in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 Nrn. 5 bis 8 SGB V Versicherten. Zwar werden in § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB XI – im Gegensatz zu der in der Krankenversicherung analogen Vorschrift des § 5 Abs. 1 Nr. 5 SGB V – neben den Einrichtungen der Jugendhilfe auch Berufsbildungswerke oder ähnliche Einrichtungen für Behinderte genannt. Dies führt allerdings zu keiner Abweichung vom Krankenversicherungsrecht, da in die Versicherungspflicht zur Krankenversicherung auch Personen einbezogen werden, die in Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für Behinderte für eine Erwerbsfähigkeit befähigt werden sollen.
2.8 Studenten, Praktikanten, Auszubildende ohne Arbeitsentgelt
Die in der Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 Nrn. 9 und 10 SGB V versicherungspflichtigen Studenten, Praktikanten, Auszubildenden ohne Arbeitsentgelt und Auszubildenden des Zweiten Bildungswegs unterliegen nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 9 und 10 in Verb. mit Satz 1 SGB XI der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung.
In § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 SGB XI werden abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 10 SGB V Personen genannt, die eine Fachschule oder Berufsfachschule besu-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 6 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
chen. Der alleinige Besuch einer der genannten Schulen begründet allerdings keine Versicherungspflicht in der Krankenversicherung, so daß wegen der Vorbehaltsklausel in § 20 Abs. 1 Satz 1 SGB XI Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nicht zustande kommt. Fach- oder Berufsfachschüler, die freiwillig krankenversichert sind, werden in der sozialen Pflegeversicherung nach § 20 Abs. 3 SGB XI der Versicherungspflicht unterstellt.
2.9 Rentner
Aufgrund des Bezugs einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind Personen nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 SGB XI versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung, soweit sie der Krankenversicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 oder 12 SGB V unterliegen. Das gilt auch für Rentner, die aufgrund des Artikels 33 § 14 GSG über den 31. 12. 1992 hinaus Mitglied der Krankenversicherung der Rentner geblieben sind, obwohl für den Bereich der Krankenversicherung eine entsprechende Gleichstellungsregelung mit den nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V krankenversicherungspflichtigen Rentnern formell fehlt.
Personen, die eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt haben (Rentenantragsteller) und die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nrn. 11 und 12 SGB V, nicht jedoch die Voraussetzungen für den Bezug der Rente erfüllen, gelten als Mitglieder der Pflegekasse (vgl. Ausführungen unter B II 1.4).
2.10 Freiwillige Krankenversicherte
In die Versicherungspflicht der sozialen Pflegeversicherung werden nach § 20 Abs. 3 SGB XI alle in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherten einbezogen. Dabei spielt es keine Rolle, aufgrund welcher Rechtsgrundlage die freiwillige Krankenversicherung zustande gekommen ist (z. B. § 9 SGB V, § 6 KVLG 1989). Unerheblich ist ferner, ob die freiwillige Versicherung im Krankheitsfalle Leistungsbeschränkungen vorsieht.
2.11 Ausschluß der Versicherungspflicht
In § 20 Abs. 4 SGB XI wird die widerlegbare Vermutung aufgestellt, daß eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht vorliegt, wenn sie von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist und in den letzten zehn Jahren keine Versicherungspflicht zur Kranken- oder Pflegeversicherung bestanden hat. Durch diese Regelung soll den Pflegekassen, vordringlich bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung von entgeltlichen Beschäftigungen unter Familienangehörigen, ein Instrument zur Mißbrauchsvermeidung in Form einer gesetzlichen Beweislastumkehr an die Hand gegeben werden.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 7 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
3 Versicherungspflicht für sonstige Personen
3.1 Allgemeines
Nach § 21 SGB XI unterliegen bestimmte Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (§ 30 SGB I) im Inland haben und weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind, der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Personen, die im Krankheitsfalle Leistungen im Rahmen einer Versorgung oder Fürsorge beanspruchen können. Da diese Sondersysteme grundsätzlich keine Leistungen bei Pflegebedürftigkeit vorsehen, wird dieses Risiko durch die Einbeziehung in die Versicherungspflicht der sozialen Pflegeversicherung abgedeckt.
3.2 Personen mit Anspruch auf Heil- oder Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz
Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 1 SGB XI besteht für Personen, die einen Anspruch auf Heil- oder Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach den Gesetzen haben, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen (z. B. Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, Bundes-Seuchengesetz, Opferentschädigungsgesetz, Erstes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz), wenn sie weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind. In die Versicherungspflicht werden im übrigen nicht nur die Beschädigten, sondern auch deren Hinterbliebene einbezogen, sofern sie Anspruch auf Krankenbehandlung haben und nicht im Rahmen der Familienversicherung nach § 25 SGB XI geschützt sind. Entsprechendes gilt für Personen, die unentgeltlich die Wartung und Pflege eines Beschädigten (Empfänger einer Pflegezulage) nicht nur vorübergehend übernommen haben.
3.3 Bezieher von Kriegsschadenrente oder vergleichbaren Leistungen
Personen, die Kriegsschadenrente oder vergleichbare Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz oder dem Reparationsschädengesetz oder laufende Beihilfe nach dem Flüchtlingshilfegesetz beziehen, sind gemäß § 21 Nr. 2 SGB XI versicherungspflichtig, wenn sie weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind.
Die Kriegsschadensrente wird nach § 253 LAG in zwei Formen gewährt, und zwar als Unterhaltshlfe oder als Entschädigungsrente. Obwohl nur die Unterhaltshilfe, die in sich das Prinzip der sozialen Sicherung vereinigt, einen Anspruch auf Krankenversorgung nach § 276 LAG auslöst, besteht Versicherungspflicht auch für die Personen, die nur Entschädigungsrente erhalten.
Bezieher von laufender Beihilfe nach dem dritten Abschnitt des Flüchtlingshilfegesetzes sind ebenfalls in die Versicherungspflicht einbezogen; diese Personen haben als zusätzliche Leistung zur Beihilfe zum Lebensunterhalt einen Anspruch auf Krankenversorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Lastenausgleichsgesetzes.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 8 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
3.4 Bezieher von ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Kriegsopferfürsorge
Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt wird nach § 27 a BVG bzw. den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgsetzes vorsehen, im Rahmen der Kriegsopferfürsorge in den Fällen gewährt, in denen die Rentenleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz nicht ausreichen, um den notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten. Besteht weder eine Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung noch ein privater Krankenversicherungsschutz, sind die Bezieher dieser Leistung in die Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 3 SGB XI einbezogen.
3.5 Bezieher von laufenden Leistungen zum Unterhalt und Leistungen der Krankenhilfe im Rahmen des Kinder- und Jugendhilferechts
Werden laufende Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen nach § 39 SGB VIII bezogen und geht damit ein Anspruch auf Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII einher, besteht Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 4 SGB XI, sofern die zu versichernde Person weder gesetzlich noch privat krankenversichert ist.
3.6 Krankenversorgungsberechtigte nach dem Bundesentschädigungsgesetz
Einen Anspruch auf Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz hat nach § 141 a BEG der Verfolgte für nicht verfolgungsbedingte Leiden. Ist die versorgungsberechtigte Person weder in der gesetzlichen Krankenversicherung noch bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert, besteht Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 5 SGB XI.
3.7 Soldaten auf Zeit
Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 6 SGB XI besteht für Soldaten auf Zeit, wenn sie weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind. Nach der Legaldefinition des § 1 Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz ist Soldat, wer aufgrund der Wehrpflicht oder freiwilliger Verpflichtung in einem Wehrdienstverhältnis steht. Das Wehrdienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Ernennung; es endet mit Ablauf des Tages, an dem der Soldat aus der Bundeswehr ausscheidet (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Soldatengesetz). Die Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 6 SGB XI wird allerdings fortgeführt, wenn der Soldat aus seinem Dienstverhältnis ausscheidet, aber Übergangsgebührnisse erhält, es sei denn, in dieser Zeit tritt ein Tatbestand der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 23 Abs. 1 SGB XI ein.
3.8 Vorrangversicherung
Die Versicherungspflicht nach § 21 SGB XI geht der Verpflichtung zum Abschluß eines privaten Pflegeversicherungsvertrages nach § 23 Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 1 SGB XI vor. Die Versicherungspflicht für Mitglieder der Postbe-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 9 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
amtenkrankenkasse (§ 23 Abs. 4 Nr. 2 SGB XI) sowie für Mitglieder der Kankenversorgung der Bundesbahnbeamten (§ 23 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI) verdrängt dagegen die Versicherungspflicht nach § 21 SGB XI.
Erfüllt eine Person gleichzeitig mehrere Versicherungspflichttatbestände des § 21 SGB XI, bestimmt sich die Versicherungspflicht nach der Reihenfolge der Aufführung der Tatbestände innerhalb des § 21 SGB XI (z. B. geht die Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 1 SGB XI der Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 3 SGB XI vor).
3.9 Wahlrecht bei Anspruchsberechtigung beider Ehegatten
In den Fällen, in denen beide Ehegatten zu einer der unter 3.2 bis 3.6 genannten Personengruppe gehören, wird nur ein Ehegatte – entsprechend ihrer Wahl – der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung unterstellt (vgl. Bundestags-Drucksache 12/5952 S. 37), vorausgesetzt, daß für den anderen Ehegatten eine Familienversicherung nach § 25 SGB XI besteht.
4 Ausgleichsgeld nach dem FELEG an landwirtschaftliche Arbeitnehmer
Bezieher von Ausgleichsgeld sind in der sozialen Pflegeversicherung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB XI versicherungspflichtig, wenn unmittelbar vor dem Beginn des Ausgleichsgeldbezugs Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung (mit Ausnahme der Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI) bestanden hat und weder Krankengeld bezogen noch eine versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt wird (§ 15 Abs. 4 FELEG). Das Erfordernis der Unmittelbarkeit wird – wie in der Krankenversicherung – regelmäßig erfüllt sein, weil die versicherungspflichtige Beschäftigung durch die Stillegung oder die Abgabe von Flächen beendet worden ist und sich das Ausgleichsgeld nahtlos anschließt.
Bezieher von Ausgleichsgeld, die während ihrer Beschäftigung im landwirtschaftlichen Unternehmen zuletzt in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung versichert waren, werden in der sozialen Pflegeversicherung über § 14 Abs. 4 FELEG der Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI unterstellt (vgl. Ausführungen unter 2.5).
5 Kündigung eines privaten Pflegeversicherungsvertrages
Personen, die bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert sind, können nach § 27 SGB XI ihren Versicherungsvertrag vorzeitig kündigen, wenn sie nachweisen, daß sie der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI unterliegen. Ein Kündigungsrecht besteht auch für die Pflegeversicherungsverträge, die bereits vor dem 23. 6. 1993 abgeschlossen wurden, wenn der Nachweis erbracht wird, daß Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI eintritt (Artikel 42 Abs. 3 PflegeVG).
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 10 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Die Kündigung des privaten Versicherungsvertrages ist mit Wirkung vom Eintritt der Versicherungspflicht an möglich. Sie kann auch rückwirkend vorgenommen werden.
Das Recht auf vorzeitige Kündigung des privaten Versicherungsvertrages haben auch die Angehörigen, wenn für sie eine Familienversicherung nach § 25 SGB XI eintritt.
III Befreiung von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung
1 Allgemeines
Freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung können sich von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung befreien lassen, wenn sie einen gleichwertigen privaten Pflegeversicherungsschutz nachweisen. Damit wird der Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ durchbrochen; es ist also möglich, daß Personen der gesetzlichen Krankenversicherung, nicht aber der sozialen Pflegeversicherung als Mitglied angehören.
Weitere Befreiungsrechte bestehen in den Überleitungsvorschriften des Pflege-Versicherungsgesetzes (vgl. Ausführungen unter F I).
2 Freiwillig krankenversicherte Mitglieder
2.1 Allgemeines
Nach § 22 Abs. 1 SGB XI können sich die freiwillig krankenversicherten Mitglieder, die in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig sind, auf Antrag von dieser Versicherungspflicht befreien lassen. Hierfür ist der Nachweis eines gleichwertigen Versicherungsschutzes bei einem privaten Versicherungsunternehmen zwingende Voraussetzung.
2.2 Voraussetzungen der Befreiung
2.2.1 Gleichwertiger Versicherungsschutz
Dem Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung kann nur dann entsprochen werden, wenn der Befreiungsberechtigte den Nachweis erbringt, daß er vom Zeitpunkt der Wirkung der Befreiung an bei einem privaten Versicherungsunternehmen gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert ist und für sich und seine Angehörigen, die bei Versicherungspflicht nach § 25 SGB XI versichert wären, Leistungen beanspruchen kann, die nach Art und Umfang den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung gleichwertig sind.
Die Gleichwertigkeit des Versicherungsschutzes setzt voraus, daß für Pflegebedürftige der privaten Unternehmen die gleichen Leistungsvoraussetzun-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 11 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
gen zum Tragen kommen, die auch in der sozialen Pflegeversicherung gelten, insbesondere Feststellung der Pflegebedürftigkeit und Zuordnung zu den Pflegestufen nach denselben Maßstäben. Darüber hinaus muß sichergestellt sein, daß der einzelne sowohl bei ambulanter als auch bei stationärer Pflege entweder Geldleistungen in der Höhe, wie sie in der sozialen Pflegeversicherung für die jeweilige Stufe der Pflegebedürftigkeit vorgesehen sind, oder aber Kostenerstattung in Höhe der für die jeweilige Pflegestufe vorgesehenen Sachleistung erhält. Dies bedeutet, daß die Leistungen auch in der privaten Pflegeversicherung in dem Rahmen anzupassen sind, in dem die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung nach § 30 SGB XI angepaßt werden.
Bei Personen, die im Falle der Pflegebedürftigkeit Beihilfeleistungen erhalten (z. B. Beamte), genügt für die Gleichwertigkeit des Versicherungsschutzes eine entsprechende anteilige Versicherung, mit der die durch die Beihilfeleistungen nicht gedeckten Aufwendungen ergänzt werden (Restkostenversicherung). Beihilfeleistungen und Vertragsleistungen zusammen müssen den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung entsprechen. Auch für diese Personen muß der Versicherungsschutz die Angehörigen, die bei Versicherungspflicht nach § 25 SGB XI versichert wären, einschließen.
Die Befreiung von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung zieht gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XI die Verpflichtung nach sich, den privaten Versicherungsschutz für die Dauer der Befreiung und im erforderlichen Umfang aufrechtzuerhalten. Hierüber wacht das private Versicherungsunternehmen. Wer vorsätzlich oder leichtfertig der Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des privaten Versicherungsvertrages nicht nachkommt, handelt ordnungswidrig.
2.2.2 Antragstellung
Der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht zu stellen (§ 22 Abs. 2 Satz 1 SGB XI). Für die Berechnung der Frist gelten nach § 26 Abs. 1 SGB X die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend.
Beispiel
| Ende der Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 in Verb. mit Satz 1 SGB XI wegen Überschreitung der JAE-Grenzen in der GKV | 31. 12. |
| Beginn der Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 3 SGB XI | 1. 1. |
| Beginn der Antragsfrist | 1. 1. |
| Ende der Antragsfrist | 31. 3. |
Fällt der letzte Tag der Antragsfrist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, endet die Frist nach § 26 Abs. 3 Satz 1 SGB X mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 12 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Die in § 22 Abs. 2 SGB XI genannte Frist ist eine von Amts wegen zu beachtende Ausschlußfrist, die nicht verlängert werden kann.
2.3 Zuständige Pflegekasse
Der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht ist bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen. Zuständig ist die Pflegekasse, die bei der Krankenkasse errichtet ist, bei der die freiwillige Mitgliedschaft besteht.
2.4 Wirkung der Befreiung
Die Befreiung wirkt vom Beginn der Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 3 SGB XI an, wenn seit diesem Zeitpunkt noch keine Leistungen (einschließlich Leistungen für nach § 25 SGB XI versicherte Angehörige) in Anspruch genommen wurden, sonst vom Beginn des Kalendermonats an, der auf die Antragstellung folgt. Die Befreiung kann nicht widerrufen werden (§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB XI).
Die Befreiung gilt für die Dauer der freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung, also solange, wie diese – ohne die Befreiung – Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach § 20 Abs. 3 SGB XI nach sich ziehen würde. Durch den Eintritt eines Versicherungspflichttatbstandes nach § 20 Abs. 1 und 2 SGB XI, § 21 SGB XI oder einer Familienversicherung nach § 25 SGB XI verliert die Befreiung ihre Wirksamkeit (vgl. Bundestags-Drucksache 12/5952 S. 37). Ein Arbeitgeberwechsel hat dagegen keinen Einfluß auf die Befreiung von der Versicherungspflicht, vorausgesetzt, die freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht nahtlos fort; das gilt selbst dann, wenn im Zusammenhang mit dem Arbeitgeberwechsel eine andere Krankenkasse gewählt wird.
IV Familienversicherung
In der sozialen Pflegeversicherung besteht für Familienangehörige eines Mitglieds unter den gleichen Voraussetzungen wie in der gesetzlichen Krankenversicherung ein Anspruch auf beitragsfreie Familienversicherung. Die Regelung des § 25 SGB XI übernimmt inhaltlich und weitgehend wörtlich die Vorschriften des § 10 SGB V und § 7 KVLG 1989.
Bei der Prüfung des Ausschlusses von der Familienversicherung nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB XI bleibt das Pflegegeld aus der Pflegeversicherung unberücksichtigt (vgl. § 13 Abs. 5 SGB XI). Das gilt auch für die finanzielle Anerkennung, die eine Pflegeperson (§ 19 SGB XI) für ihre Tätigkeit von dem Pflegebedürftigen erhält, als diese das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im Sinne des § 37 SGB XI nicht übersteigt.
Die Familienversicherung bleibt nach § 25 Abs. 4 SGB XI bei den Kindern im Sinne des § 25 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 SGB XI, die aufgrund gesetzlicher Pflicht mehr als drei Tage Wehr- oder Zivildienst leisten, für die Dauer der gesetzlichen Dienstpflicht bestehen. Während der Anspruch auf Leistungen aus der
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 13 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
gesetzlichen Krankenversicherung für die Zeit der Dienstpflicht ruht (vgl. § 16 Abs. 1 Nr. 2 SGB V), erhalten diese Personen die Leistungen der Pflegeversicherung zur Hälfte (vgl. § 28 Abs. 2 SGB XI).
V Weiterversicherung
1 Allgemeines
Wie im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, sieht die soziale Pflegeversicherung in § 26 Abs. 1 SGB XI die Möglichkeit vor, nach dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht die Versicherung in der Pflegeversicherung auf Antrag freiwillig fortzusetzen. Das Recht zur Weiterversicherung besteht allerdings dann nicht, wenn Versicherungspflicht nach § 23 SGB XI eintritt. Die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung haben nach § 26 Abs. 2 SGB XI auch Personen, deren Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung wegen der Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland endet. Sinn und Zweck dieser Weiterversicherungsmöglichkeit ist, bereits erworbene Anwartschaften durch den weiteren Erwerb von Vorversicherungszeiten zu erhalten.
2 Weiterversicherungsrecht nach § 26 Abs. 1 SGB XI
2.1 Versicherungsberechtigter Personenkreis
Das Recht zur freiwilligen Weiterversicherung nach § 26 Abs. 1 SGB XI haben
- – Personen, die aus der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI ausgeschieden sind,
- – Personen, deren Familienversicherung nach § 25 SGB XI erlischt oder nur deswegen nicht besteht, weil die Voraussetzungen des § 25 Abs. 3 SGB XI vorliegen.
Dagegen steht die Versicherungsberechtigung den Personen nicht zu, die zwar aus der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI ausscheiden, allerdings verpflichtet sind, einen privaten Pflegeversicherungsvertrag nach § 23 SGB XI abzuschließen.
2.2 Vorversicherungszeit
Die freiwillige Weiterversicherung hängt – analog den entsprechenden Krankenversicherungsregelungen – vom Nachweis bestimmter Vorversicherungszeiten ab. Gefordert wird, daß entweder
- – in den letzten fünf Jahren vor dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI mindestens 24 Monate
oder - – unmittelbar vor dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI mindestens zwölf Monate
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 14 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
eine Versicherung in der sozialen Pflegeversicherung bestanden hat (§ 26 Abs. 1 Satz 1 SGB XI).
Anzurechnende Versicherungszeiten sind Zeiten der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI, Zeiten der Weiterversicherung nach § 26 SGB XI sowie Zeiten der Familienversicherung nach § 25 SGB XI. Zeiten der Mitgliedschaft als Rentenantragsteller nach § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 189 SGB V oder § 23 KVLG 1989 bleiben dagegen unberücksichtigt. Das gilt dann jedoch nicht, wenn der Rentenantrag eine dem Grunde nach bestehende Familienversicherung nach § 25 SGB XI verdrängt.
Reicht die für die Ermittlung der Vorversicherungszeit zu bildende Rahmenfrist in die Zeit vor Inkrafttreten des Pflege-Versicherungsgesetzes, so können Versicherungszeiten dann berücksichtigt werden, sofern sie berücksichtigungsfähig gewesen wären, wenn die Pflegeversicherung zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden hätte.
Für Personen, die aus der Familienversicherung nach § 25 SGB XI ausscheiden sowie für Neugeboren, deren Familienversicherung wegen der Vorschriftt des § 25 Abs. 3 SGB XI nicht zustande kommt, wird eine Vorversicherungszeit nicht verlangt. Dies ergibt sich auch aus dem Hinweis auf § 25 Abs. 3 SGB XI in § 26 Abs. 1 Satz 2 SGB XI.
2.3 Antragstellung
Die Weiterversicherung kommt nur dann zustande, wenn die versicherungsberechtigte Person ihren Willen zur Weiterversicherung durch einen fristgerechten Antrag anzeigt. Entgegen § 188 Abs. 3 SGB V ist die Schriftform für den Weiterversicherungsantrag in der sozialen Pflegeversicherung nicht zwingend.
Der Antrag ist
- – bei Personen, die aus der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI ausgeschieden sind, innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Mitgliedschaft,
- – bei Personen, deren Familienversicherung nach § 25 SGB XI erlischt oder nur deswegen nicht besteht, weil die Voraussetzungen des § 25 Abs. 3 SGB XI vorliegen, innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Familienversicherung oder nach Geburt des Kindes
bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen (§ 26 Abs. 1 Satz 3 SGB XI).
Für die Berechnung der Frist gelten nach § 26 Abs. 1 SGB X die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. Da der Beginn der Frist nicht von einem Ereignis abhängt, das in den Lauf eines Tages fällt, ist für die Berechnung der Frist § 187 Abs. 2 in Verb. mit § 188 Abs. 2 BGB maßgebend. Das bedeutet, daß die Anzeigefrist mit dem Tag nach der Beendigung der Mitgliedschaft bzw. der Familienversicherung oder nach dem Tage nach der Geburt des Kindes beginnt. Die Frist endet mit Ablauf desjenigen Tages des dritten Monats, der dem Tage vorhergeht, der durch seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 15 – SGB XI, 5. Lfg. VI/96 |
Es handelt sich hierbei um eine Ausschlußfrist; wird sie versäumt, ist das Recht zur Weiterversicherung verwirkt.
2.4 Zuständige Pflegekasse
Der Antrag auf Weiterversicherung ist an die Pflegekasse zu richten, die die Weiterversicherung durchzuführen hat.
Der Antrag gilt allerdings selbst dann als fristgerecht gestellt, wenn er innerhalb der Frist bei einem unzuständigen Leistungsträger eingeht (vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB I).
3 Weiterversicherungsrecht nach § 26 Abs. 2 SGB XI
3.1 Versicherungsberechtigter Personenkreis
Nach § 26 Abs. 2 SGB XI haben Personen, die wegen der Verlegung ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland aus der Versicherungspflicht ausscheiden, die Möglichkeit der Weiterversicherung auf Antrag. Dies gilt entgegen dem Wortlaut des Gesetzes auch für Personen, die bereits im Ausland wohnen und im Inland beschäftigt sind (Grenzgänger), wenn ihre Versicherungspflicht bei Aufgabe der Beschäftigung im Inland endet (vgl. Bundestags-Drucksache 12/5262 S. 107).
Ein „Weiterversicherungsrecht“ besteht auch für Arbeitnehmer, deren gesetzliche Krankenversicherung wegen Beschäftigung im Ausland bereits vor dem 1. 1. 1995 endet und die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben.
3.2 Antragstellung
Der Antrag auf Weiterversicherung wegen Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland ist spätestens einen Monat nach dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen (§ 26 Abs. 2 Satz 2 SGB XI). Bei den Arbeitnehmern, deren gesetzliche Krankenversicherung wegen Beschäftigung im Ausland bereits vor dem 1. 1. 1995 endet und die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben, endet die Frist zur „Weiterversicherung“ am 31. 3. 1995.
3.3 Zuständige Pflegekasse
Zuständig für die Entgegennahme des Antrags auf Weiterversicherung ist die Pflegekasse, bei der der Berechtigte bislang versichert war.
Der Antrag gilt allerdings auch dann als fristgerecht gestellt, wenn er innerhalb der Frist bei einem unzuständigen Leistungsträger eingeht (vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB I).
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 16 – SGB XI, 5. Lfg. VI/96 |
VI Versicherungspflicht in der privaten Pflegeversicherung
1 Allgemeines
Um das Ziel, die Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit für möglichst alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen, wird neben der sozialen Pflegeversicherung für die bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versicherten Personen eine private Pflege-Pflichtversicherung eingeführt.
Darüber hinaus werden bestimmte Personen dem System der privaten Pflege-Pflichtversicherung zugewiesen, die ihren Krankenversicherungsschutz zwar nicht aus der privaten Krankenversicherung herleiten, sondern – analog den in § 21 SGB XI genannten Personengruppen – Ansprüche auf Leistungen im Krankheitsfalle aus Sondersystemen geltend machen können.
2 Personenkreis
2.1 Privat Krankenversicherte
Nach § 23 Abs. 1 SGB XI haben Personen, die gegen das Risiko Krankheit bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen bei Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen versichert sind, zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit einen Versicherungsvertrag abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Eine private Zusatz- oder Reisekrankenversicherung oder eine Krankenhaustagegeldversicherung löst diese Versicherungspflicht nicht aus.
2.2 Sonstige Personen
Die Verpflichtung zum Abschluß eines anteiligen beihilfekonformen Versicherungsvertrages besteht nach § 23 Abs. 3 SGB XI auch für Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe haben, sofern sie nicht nach § 23 Abs. 1 SGB XI oder in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig sind.
Darüber hinaus besteht Versicherungspflicht in der privaten Pflege-Pflichtversicherung auch für Heilfürsorgeberechtigte, die nicht in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig sind (z. B. Berufssoldaten und Polizeivollzugsbeamte im Bundesgrenzschutz), sowie für Beamte der Unternehmen der Deutschen Bundespost und des Bundeseisenbahnvermögens (§ 23 Abs. 4 SGB XI), sofern sie Mitglieder der Postbeamtenkrankenkasse oder der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten sind.
3 Gleichwertigkeit des Versicherungsschutzes
Der private Pflegeversicherungsvertrag muß vom Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht an Leistungen vorsehen, die nach Art und Umfang den
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 17 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung gleichwertig sind, und zwar nicht nur für das Mitglied selbst, sondern auch für die Familienangehörigen, für die bei Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung Anspruch auf Familienversicherung im Sinne des § 25 SGB XI bestünde (§ 23 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). Hinsichtlich der Gleichwertigkeit des Versicherungsschutzes wird auf die Ausführungen unter III 2.2.1 verwiesen.
4 Zuständigkeit der Versicherungsunternehmen
Grundsätzlich werden die privat Krankenversicherten nach § 23 SGB XI verpflichtet, bei ihrem Krankenversicherungsunternehmen auch das Pflegerisiko abzusichern und den Versicherungsvertrag für die Dauer der Versicherungspflicht aufrechtzuerhalten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, für die Pflegeversicherung ein anderes privates Versicherungsunternehmen zu wählen (§ 23 Abs. 2 Satz 1 SGB XI). Das Wahlrecht ist gemäß § 23 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB XI innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht auszuüben. Es kann von Personen, für die am 1. 1. 1995 Versicherungspflicht in der privaten Pflegeversicherung eintritt, gemäß Artikel 41 Abs. 2 PflegeVG auch schon vor dem 1. 1. 1995 mit Wirkung zum 1. 1. 1995 ausgeübt werden. Die allgemeinen Kündigungsmöglichkeiten des Versicherungsnehmers bleiben davon jedoch unberührt. Die privaten Versicherungsnehmer unterliegen einem Kontrahierungszwang. Sie dürfen den zur Versicherung Verpflichteten nicht abweisen.
5 Ausnahme der Versicherungspflicht in der privaten Pflegeversicherung
Von der Versicherungspflicht in der privaten Pflege-Pflichtversicherung sind nach § 23 Abs. 5 SB XI die Personen ausgenommen, die bereits bestimmte Entschädigungsleistungen bei stationärer Pflege erhalten. Diese Personen sind auch in der sozialen Pflegeversicherung beitragsfrei gestellt (vgl. § 56 Abs. 4 SGB XI), da wegen der Vorrangigkeit der Entschädigungsleistungen Leistungen aus der Pflegeversicherung nicht geltend gemacht werden können. Gleiches gilt damit auch in der privaten Pflege-Pflichtversicherung.
Hat der Leistungsempfänger jedoch Familienangehörige, für die in der sozialen Pflegeversicherung nach § 25 SGB XI eine Familienversicherung bestünde, besteht die Verpflichtung zum Abschluß eines privaten Versicherungsvertrages für diese Famlienangehörigen.
VII Versicherungspflicht der Abgeordneten
Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parlaments und der Parlamente der Länder (Abgeordnete), die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, sind dem jeweiligen Parlamentspräsidenten gegenüber
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 18 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
zum Nachweis verpflichtet, daß sie gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit abgesichert sind (§ 24 SGB XI). Dieser Nachweis ist auch zu erbringen, wenn eine Versicherung nach § 20 Abs. 3 oder § 23 Abs. 1 SGB XI besteht. Das gleiche gilt für die Bezieher von Versorgungsleistungen nach den jeweiligen Abgeordnetengesetzen des Bundes und der Länder.
B Zuständigkeit, Mitgliedschaft
I Pflegekassenzuständigkeit
1 Zuständigkeit für Versicherte einer Krankenkasse
Für die Durchführung der Pflegeversicherung der nach § 20 SGB XI Versicherungspflichtigen ist jeweils die Pflegekasse zuständig, die bei der Krankenkasse errichtet ist, bei der eine Pflichtmitgliedschaft oder eine freiwillige Mitgliedschaft besteht (§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB XI). Damit ist eine einheitliche Zuständigkeit zwischen Krankenversicherung und Pflegeversicherung gegeben. Wechselt das Mitglied die Krankenkasse, ist damit automatisch ein Wechsel der Pflegekasse verbunden.
2 Zuständigkeit für sonstige Versicherte
Wegen der fehlenden Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse ist für die nach § 21 Nrn. 1 bis 5 SGB XI Versicherungspflichtigen grundsätzlich die Pflegekasse für die Durchführung der Pflegeversicherung zuständig, die bei der Krankenkasse errichtet ist, die mit der Leistungserbringung im Krankheitsfalle beauftragt ist (§ 48 Abs. 2 Satz 1 SGB XI).
Hierunter fallen die Personen,
- – die nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, einen Anspruch auf Heil- oder Krankenbehandlung haben (§ 21 Nr. 1 SGB XI), da diese Leistungen nach § 18 c Abs. 2 Satz 1 BVG von der Krankenkasse erbracht werden,
- – die krankenversorgungsberechtigt nach dem Bundesentschädigungsgesetz sind (§ 21 Nr. 5 SGB XI), da nach § 227 a BEG eine Krankenkasse mit der Durchführung der Krankenversorgung beauftragt ist.
Die nach § 21 Nrn. 2 bis 4 SGB XI Versicherungspflichtigen, die ihre Leistungen im Krankheitsfalle in der Regel nicht über eine Krankenkasse erhalten, können ihre Pflegekasse nach Maßgabe des § 48 Abs. 3 SGB XI wählen (§ 48 Abs. 2 Satz 2 SGB XI). Das gleiche Wahlrecht steht auch den nach § 21 Nr. 6 SGB XI versicherten Soldaten auf Zeit zu. Danach können diese Personen die Mitgliedschaft wählen bei der Pflegekasse, die bei
- – der Krankenkasse errichtet ist, der sie angehören würden, wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig wären; das ist
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 19 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
- bei den nach § 21 Nr. 6 SGB XI Versicherungspflichtigen die Pflegekasse, die bei der AOK des Beschäftigungs- bzw. Standorts errichtet ist oder die See-Pflegekasse,
- – der AOK des Wohnortes oder gewöhnlichen Aufenthaltes errichtet ist,
- – einer Ersatzkasse errichtet ist, wenn sie zu dem Mitgliederkreis gehören, den die gewählten Ersatzkasse aufnehmen darf.
Die gewählte Pflegekasse darf die Mitgliedschaft nicht ablehnen.
Hinsichtlich einer erneuten Ausübung des Wahlrechts gilt § 184 Abs. 7 Satz 2 SGB V entsprechend. Das heißt, die Mitgliedschaft bei der neu gewählten Pflegekasse beginnt mit Ablauf des auf die Ausübung des Wahlrechts folgenden übernächsten Monats.
Vom 1. 1. 1996 an gelten die allgemeinen Wahlrechte des § 173 Abs. 2 SGB V hinsichtlich der Pflegekassenzuständigkeit auch für die Personen, denen bis dato ein Wahlrecht nach § 48 Abs. 3 Satz 1 SGB XI zustand, vorausgesetzt, sie könnten eine der dort genannten Krankenkassen wählen, wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig wären (§ 48 Abs. 3 Satz 2 SGB XI). § 175 Abs. 4 SGB V gilt vom 1. 1. 1996 an ebenfalls entsprechend.
3 Zuständigkeit für Familienversicherte
Für die nach § 25 SGB XI Familienversicherten ist die Pflegekasse des Mitglieds zuständig (§ 48 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). Sind die Voraussetzungen der Familienversicherung mehrfach erfüllt, gilt die in der Krankenversicherung ausgeübte Wahl auch für die Pflegeversicherung.
4 Zuständigkeit für Weiterversicherte
Im Falle der Weiterversicherung nach § 26 SGB XI bleibt die Pflegekasse zuständig, bei der zuletzt eine Mitgliedschaft bestand.
II Mitgliedschaft
1 Beginn der Mitgliedschaft
1.1 Versicherungspflichtige nach § 20 SGB XI
Die Mitgliedschaft der nach § 20 SGB XI Versicherungspflichtigen beginnt mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen des § 20 SGB XI vorliegen. Damit wird der Beginn der Mitgliedschaft für Personen, die Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung sind, an die Krankenversicherungsregelungen angebunden.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 20 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
1.2 Versicherungspflichtige nach § 21 SGB XI
Die Mitgliedschaft der nach § 21 SGB XI Versicherungspflichtigen beginnt mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen des § 21 SGB XI vorliegen. Das ist
- – bei den in § 21 Nr. 1 SGB XI Genannten der Beginn des Anspruchs auf Heil- und Krankenbehandlung,
- – bei den in § 21 Nrn. 2 bis 4 SGB XI Genannten der Beginn der dort aufgeführten Leistungen,
- – bei den in § 21 Nr. 5 SGB XI Genannten der Beginn des Anspruchs auf Krankenversorgung,
- – bei den in § 21 Nr. 6 SGB XI Genannten die Ernennung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Soldatengesetz). Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ernennung ist der Tag der Aushändigung der Ernennungsurkunde, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist (§ 41 Abs. 2 Soldatengesetz).
1.3 Weiterversicherte nach § 26 SGB XI
Bei Personen, die von ihrem Recht der Weiterversicherung Gebrauch machen, schließt sich die Mitgliedschaft nahtlos an die vorhergehende Mitgliedschaft aufgrund der Versicherungspflicht nach den §§ 20 oder 21 SGB XI an (Umkehrschluß aus § 49 Abs. 1 Satz 2 letzter Satzteil SGB XI).
Die Mitgliedschaft der in § 26 Abs. 1 Satz 2 SGB XI genannten Versicherungsberechtigten beginnt mit dem Tage nach der Beendigung der Versicherung nach § 25 SGB XI bzw. mit dem Tage der Geburt.
1.4 Rentenantragsteller
Durch den Hinweis in § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI auf § 189 SGB V gelten als Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung auch Personen, die eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt haben (Rentenantragsteller) und die sonstigen Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 SGB XI, jedoch nicht die Voraussetzungen für den Bezug der Rente erfüllen. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Stellung des Rentenantrags, sofern nicht Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften besteht.
Ebenso gelten nach dem Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung als Antragsteller auf Rente aus der Alterssicherung der Landwirte versicherten Personen als Mitglieder der Pflegeversicherung. Die Mitgliedschaft beginnt analog § 23 KVLG 1989 mit dem Tag der Stellung des Antrags auf diese Rente, sofern nicht Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften besteht oder nicht eine wirksame Erklärung nach § 23 Abs. 2 KVLG 1989 auf Aufschieben der Mitgliedschaft in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung abgegeben worden ist. Entsprechendes gilt für die Antragsteller auf Produktionsaufgaberente oder Ausgleichsgeld.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 21 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
2 Ende der Mitgliedschaft
2.1 Tod
Die Mitgliedschaft bei einer Pflegekasse endet mit dem Tod des Mitglieds (§ 49 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB XI).
2.2 Versicherungspflichtige nach § 20 SGB XI
Die Mitgliedschaft der nach § 20 SGB XI Versicherungspflichtigen endet mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen des § 20 SGB XI entfallen (§ 49 Abs. 1 Satz 2 SGB XI).
2.3 Versicherungspflichtige nach § 21 SGB XI
Die Mitgliedschaft der nach § 21 SGB XI Versicherungspflichtigen endet mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen des § 21 SGB XI entfallen (§ 49 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). Das ist
- – bei den in § 21 Nr. 1 SGB XI Genannten das Ende des Anspruchs auf Heil- oder Krankenbehandlung,
- – bei den in § 21 Nrn. 2 bis 4 SGB XI Genannten das Ende des Bezugs der dort aufgeführten Leistungen,
- – bei den in § 21 Nr. 5 SGB XI Genannten das Ende des Anspruch auf Krankenversorgung,
- – bei den in § 21 Nr. 6 SGB XI Genannten der Ablauf der Zeit, für die der Soldat auf Zeit in das Dienstverhältnis berufen worden ist (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz). Das Dienstverhältnis endet gemäß § 54 Abs. 2 Soldatengesetz ferner durch
- – Entlassung,
- – Verlust der Rechtsstellung eines Soldaten auf Zeit entsprechend dem § 48 Soldatengesetz,
- – Entfernung aus dem Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit.
2.4 Weiterversicherte nach § 26 SGB XI
Die Mitgliedschaft Weiterversicherter endet
- – mit Beginn einer Versicherungspflicht nach den §§ 20, 21 oder 23 Abs. 1 SGB XI,
- – mit Beginn einer Familienversicherung nach § 25 SGB XI
oder - – mit Ablauf des übernächsten Kalendermonats, gerechnet von dem Monat, in dem das Mitglied den Austritt erklärt, wenn die Satzung nicht einen früheren Zeitpunkt bestimmt (§ 49 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XI).
Darüber hinaus endet die Mitgliedschaft der nach § 26 Abs. 2 SGB XI Weiterversicherten bei Zahlungsverzug mit Ablauf des nächsten Zahltages, wenn für zwei Monate die fälligen Beiträge trotz Hinweises auf die Folgen nicht entrichtet wurden.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 22 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
2.5 Rentenantragsteller
Die Mitgliedschaft von Antragstellern auf Rente aus der gesetzliche Rentenversicherung und aus der Alterssicherung der Landwirte sowie von in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung versicherten Antragstellern auf Produktionsaufgaberente oder Ausgleichsgeld endet – wie in der Krankenversicherung – mit dem Tag, an dem der Antrag zurückgenommen oder die Ablehnung des Antrags unanfechtbar wird. Darüber hinaus wird die Mitgliedschaft aufgrund ihrer Subsidiarität dann beendet bzw. ausgeschlossen, wenn Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften besteht bzw. eintritt.
3 Fortbestand der Mitgliedschaft
Die mitgliedschaftserhaltenden Vorschriften der Krankenversicherung (§ 192 SGB V, § 25 KVLG) gelten nach § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI für die Pflegeversicherung entsprechend. Damit ist der Erhalt der Mitgliedschaft bei Arbeitsunterbrechnungen ohne Arbeitsentgeltzahlung sowie beim Bezug bestimmter Entgeltersatzleistungen auch in der Pflegeversicherung gewährleistet. Darüber hinaus bleibt die Mitgliedschaft von Schwangeren erhalten, deren Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber zulässig aufgelöst oder die unter Wegfall des Arbeitsentgelts beurlaubt worden sind, sofern sie nicht anderweitig versichert sind.
Obwohl vom Gesetzgeber nicht ausdrücklic genannt, gilt auch § 193 SGB V entsprechend, d. h, eine bestehende Mitgliedschaft in der Pflegeversicherung wird durch den Wehr- oder Zivildienst nicht berührt. In den Fällen des § 193 Abs. 1 SGB V gilt ein Beschäftigungsverhältnis als durch den Wehr- oder Zivildienst nicht unterbrochen.
Solange Anspruch auf Kurzarbeiter- oder Schlechtwettergeld besteht, gilt für die Mitgliedschaft in der Pflegeversicherung § 162 AFG entsprechend.
C Meldungen
I Meldungen für Versicherte einer Krankenkasse
Die Meldung zur gesetzlichen Krankenversicherung schließt die Meldung zur sozialen Pflegeversicherung ein. Bei freiwillig versicherten Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherten gilt die Beitrittserklärung zur gesetzlichen Krankenversicherung als Meldung zu sozialen Pflegeversicherung (§ 50 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz und Satz 3 SGB XI). Damit wird die in § 50 Abs. 1 Satz 1 SGB XI bestehende Verpflichtung, sich unmittelbar nach Eintritt des die Versicherungspflicht auslösenden Tatbestandes bei der zuständigen Pflegekasse anzumelden, für die nach § 20 SGB XI Versicherungspflichtigen praktisch aufgehoben.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 23 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
II Meldungen für sonstige Versicherte
Für die nach § 21 SGB XI Versicherungspflichtigen haben gemäß § 50 Abs. 2 SGB XI die dort näher bezeichneten Stellen eine Meldung an die zuständigen Pflegekassen zu erstatten, da die Pflegekassen bei diesen Personen – wegen der fehlenden Mitgliedschaft in der Krankenversicherung – nicht auf die bei den Krankenkassen vorliegenden Meldungen zurückgreifen können.
Die Meldung an die zuständige Pflegekasse hat zu erstatten
- – nach § 50 Abs. 2 Nr. 1 SGB XI das Versorgungsamt für die nach § 21 Nr. 1 SGB XI Versicherungspflichtigen,
- – nach § 50 Abs. 2 Nr. 2 SGB XI das Ausgleichsamt für die nach § 21 Nr. 2 SGB XI Versicherungspflichtigen,
- – nach § 50 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI der Träger der Kriegsopferfürsorge für die nach § 21 Nr. 3 SGB XI Versicherungspflichtigen,
- – nach § 50 Abs. 2 Nr. 4 SGB XI der Leistungsträger der Jugendhilfe für die nach § 21 Nr. 4 SGB XI Versicherungspflichtigen,
- – nach § 50 Abs. 2 Nr. 5 SGB XI die Entschädigungsbehörden der Länder für die nach § 21 Nr. 5 SGB XI Versicherungspflichtigen,
- – nach § 50 Abs. 2 Nr. 6 SGB XI der Dienstherr für die nach § 21 Nr. 6 SGB XI Versicherungspflichtigen.
Näheres zum Meldeverfahren für die nach § 21 Nrn. 1 bis 5 SGB XI Versicherten wird in einer gesonderten Verfahrensbeschreibung festgelegt.
D Beiträge
I Grundsatz
1 Allgemeines
Das Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung entspricht weitgehend dem Beitragsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung. Abweichungen gibt es allerdings insbesondere dort, wo die Schaffung eines neuen Sozialversicherungszweiges einschließlich der Einbeziehung sonstiger (nicht gesetzlich krankenversicherter) Personen in die Versicherungspflicht systembedingt Regelungen erfordert, die nicht durch die der gesetzlichen Krankenversicherung abgedeckt sind.
2 Beitragspflicht
Beiträge sind entsprechend § 54 Abs. 2 Satz 2 SGB XI grundsätzlich für jeden Kalendertag der Mitgliedschaft in der sozialen Pflegeversicherung zu zahlen. Für die Berechnung der Beiträge ist die Woche mit sieben, der Monat zu 30 und das Jahr zu 360 Tagen anzusetzen. Beginnt oder endet die Mitgliedschaft im Laufe eines Kalendermonats, ist für die Beitragsberechnung von der tatsächlichen Anzahl der verbleibenden Kalendertage des entsprechenden Monats auszugehen.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 24 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Die Beiträge werden nach einem Beitragssatz von den beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder bis höchstens zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben (§ 54 Abs. 2 Satz 1 SGB XI).
3 Rechengrößen im Beitrittsgebiet
Durch die Verweisung in § 54 Abs. 3 SGB XI auf die Vorschriften des Zwölften Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gelten für Versicherte, die einer Pflegekasse angehören, die bei einer Krankenkasse mit Sitz in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet (Beitrittsgebiet) errichtet ist, die bis zur Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse abweichenden Rechengrößen auch für die Berechnung der Beiträge zur Pflegeversicherung. Entsprechendes gilt für Versicherte von Pflegekassen, die bei solchen Krankenkassen errichtet sind, die sich auf das Beitrittsgebiet erstreckt haben.
Vom 1. 1. 1995 an gelten die Vorschriften des Zwölften Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – von Einzelvorschriften abgesehen – nicht mehr im Land Berlin. Dies bedeutet, daß vom 1. 1. 1995 an in der Krankenversicherung und damit auch in der sozialen Pflegeversicherung für Gesamt-Berlin einheitliche Rechengrößen gelten, und zwar die der alten Bundesländer.
4 Landwirtschaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familienangehörige
Für landwirtschaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familienangehörige treten bezüglich der Beitragsbemessung an die Stelle des in § 57 Abs. 1 SGB XI genannten § 226 SGB V die §§ 39 bis 42 KVLG 1989. Für die Berechnung des Beitrags, der nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte aus dem Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft zu zahlen ist, gelten die Ausführungen unter IV 4 entsprechend.
II Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze
1 Beitragssatz
Der Beitragssatz wird durch Gesetz festgelegt. Er beträgt gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 SGB XI
- – für die Zeit vom 1. 1. 1995 bis zum 3. 6. 1996 1 v. H.,
- – in der Zeit vom 1. 7. 1996 an 1,7 v. H.
der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder.
Als Folge der Halbierung ihrer Leistungsansprüche (vgl. § 28 Abs. 2 SGB XI) beträgt der Beitragssatz für Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, die Hälfte des „normalen“ Beitragssatzes (§ 55 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). Unter diese Regelung fallen in erster Linie die nach § 20 Abs. 3 SGB XI versicherungspflichtigen Beamten, Richter, Soldaten auf
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 25 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Zeit sowie Berufssoldaten und sonstigen Beschäftigten des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde, von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Stiftungen oder Verbänden öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder deren Spitzenverbänden, Geistlichen der als öffentlich-rechtlichen Körperschaften anerkannten Religionsgemeinschaften sowie Pensionäre, aber auch die nach § 21 Nr. 6 SGB XI versicherungspfichtigen Soldaten auf Zeit; diese Personen erhalten keinen Beitragszuschuß.
Der halbe Beitragssatz gilt ferner für beschäftigte Beamtenwitwen/-witwer und Vollwaisen von Beamten sowie für versicherungspflichtige Rentner, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege einen eigenen Anspruch auf Beihilfe haben. Dies gilt entsprechend für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI versicherungspflichtigen Altenteiler und die nach § 14 Abs. 4 FELEG versicherungspflichtigen Bezieher von Produktionsaufgaberenten oder Ausgleichsgeld.
2 Beitragsbemessungsgrenze
Die beitragspflichtigen Einnahmen (§ 57 SGB XI) sind höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze zu berücksichtigen. Die Beitragsbemessungsgrenze in der sozialen Pflegeversicherung beträgt 75 v. H. der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten (§ 55 Abs. 2 SGB XI); sie ist mit der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung identisch.
Bei der Berechnung der Beitragsbemessungsgrenze für andere Bemessungszeiträume als das Kalenderjahr ist wie in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung auch nach den Beitragsberechnungs-Richtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung vom 16. September 1975 (Bundesarbeitsblatt 1975 S. 587) zu verfahren.
| 1995 | Pflegeversicherung | |
|---|---|---|
| Zeitraum Jahr |
West 70 200,00 DM |
Ost 57 600,00 DM |
| Monat Woche Kalendertag |
5 850,00 DM 1 365,00 DM 195,00 DM |
4 800,00 DM 1 120,00 DM 160,00 DM |
III Beitragsfreiheit
1 Familienangehörige
Die nach § 25 SGB XI versicherten Familienangehörigen sind für die Dauer der Familienversicherung beitragsfrei nach § 56 Abs. 1 SGB XI. Da die Beitragsfreiheit (als Ausnahme von der Beitragspflicht) nur dann rechtsbegrün-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 26 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
dende Wirkung entfalten kann, wenn ohne sie Beitragspflicht bestünde, dies aber wegen der im Hinblick auf § 54 Abs. 2 Satz 2 SGB XI fehlenden Mitgliedschaft bei Familienangehörigen nicht der Fall ist, hat die Regelung des § 56 Abs. 1 SGB XI mehr erklärenden Charakter.
2 Rentenantragsteller
Beitragsfrei nach § 56 Abs. 2 Satz 1 SGB XI ist – wie in der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. § 225 Satz 1 SGB V, § 44 Abs. 2 KVLG 1989) – ein Antragsteller auf Rente wegen Todes (gilt nicht für Erziehungs- oder Geschiedenenrente) vom Zeitpunkt der Rentenantragstellung bis zum Beginn der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder der Alterssicherung der Landwirte, vorausgesetzt, der Verstorbene bezog zum Zeitpunkt seines Todes bereits eine solche Rente.
Ferner sind auch solche Rentenantragsteller von der Beitragspflicht freigestellt, für die ohne die Rentenantragstellermitgliedschaft eine Familienversicherung nach § 25 SGB XI bestünde. Zwar sieht das Elfte Buch Sozialgesetzbuch eine explizite Regelung nicht vor; die Argumente, die bei Einführung des § 381 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 RVO bzw. des § 64 Abs. 1 Satz 2 Satzteil 2 KVLG [ab 1. 1. 1989 § 225 Satz 1 Nr. 3 SGB V, § 44 Abs. 2 KVLG 1989] hinsichtlich der Beitragsfreistellung zur Krankenversicherung ausschlaggebend waren, dürften aber gleichermaßen auch auf das Beitragsrecht der Pflegeversicherung übertragbar sein.
Beitragsfreiheit besteht jedoch nicht, soweit der Rentenantragsteller eine eigene Rente, Arbeitseinkommen oder Versorgungsbezüge erhält (§ 56 Abs. 2 Satz 2 SGB XI). Mithin sind ansonsten beitragsfreie Rentenantragsteller insoweit beitragspflichtig, als sie eine der vorgenannten Einnahmen erzielen. Hinsichtlich der aus dem Zahlbetrag der Versorgungsbezüge sowie aus Arbeitseinkommen zu bemessenden Beiträge gilt § 226 Abs. 2 SGB V bzw. § 45 Abs. 2 Satz 1 KVLG 1989 entsprechend.
3 Bezieher von Mutterschafts- oder Erziehungsgeld
Die Beitragsfreiheit für Mitglieder während der Dauer des Bezugs von Mutterschafts- oder Erziehungsgeld ist in § 56 Abs. 3 SGB XI geregelt. Satz 2 dieser Vorschrift stellt klar, daß sich die Beitragsfreiheit nur auf die Leistung selber, also auf das Mutterschafts- oder Erziehungsgeld bezieht. Folglich unterliegen die während des Bezugs dieser Leistungen weitergewährten Einnahmen (z. B. Rente, Versorgungsbezüge, Arbeitseinkommen) der Beitragspflicht. Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld gehören nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ArEV auch im Beitragsrecht der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung nicht zum Arbeitsentgelt und sind daher nicht mit Beiträgen zu belegen. Dagegen unterliegen Zuschüsse zum Erziehungsgeld der Beitragspflicht.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 27 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
4 Bezieher bestimmter Entschädigungsleistungen
4.1 Allgemeines
Mitglieder der Pflegekasse sind nach § 56 Abs. 4 SGB XI auf Antrag beitragsfrei, wenn sie sich auf nicht absehbare Dauer in stationärer Pflege befinden und bestimmte Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit erhalten. Diese Regelung steht in engem Zusammenhang mit der Vorschrift des § 13 Abs. 1 SGB XI, wonach bestimmte Entschädigungsleistungen gegenüber den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung als vorrangig anzusehen sind und der einzelne somit grundsätzlich keine Leistungen der sozialen Pflegeversicherung in Anspruch nehmen kann. Beitragsfreiheit kommt jedoch dann nicht zustande, wenn und solange das Mitglied Familienangehörige hat, für die eine Versicherung nach § 25 SGB XI besteht.
Eine befristete Beitragsfreiheit besteht im übrigen für Pflegebedürftige, die vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim erhalten (vgl. Artikel 47 PflegeVG), ohne daß bestimmte Entschädigungsleistungen bezogen werden.
4.2 Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit
4.2.1 Stationäre Pflege auf nicht absehbare Dauer
Stationäre Pflege wird in einer stationären Pflegeeinrichtung erbracht. Stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) sind selbständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige
- – unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegekraft gepflegt werden und
- – ganztägig (vollstationär) untergebracht und verpflegt werden können.
Das Erfordernis der Unterbringung „auf nicht absehbare Dauer“ gilt beim Bezug einer der unter 4.2.2 genannten Leistungen grundsätzlich als erfüllt.
4.2.2 Bezug bestimmter Entschädigungsleistungen
Zur Beitragsfreiheit führt der Bezug folgender Entschädigungsleistungen:
- – Leistungen nach § 34 BeamtenVG, die ein Beamter, Richter oder Soldat, der aufgrund eines Dienstunfalles pflegebedürftig wird, erhält. Im Falle stationärer Pflege werden die Heimkosten einschließlich der Unterbringungs- und Verpflegungskosten erstattet, wobei häusliche Ersparnisse angerechnet werden. Nach Eintritt in den Ruhestand ist dem Verletzten auf Antrag anstelle der Kostenerstattung für die Dauer der Hilflosigkeit ein Zuschlag zum Unfallruhegehalt zu gewähren. Der Anspruch auf diese Unfallfürsorgeleistungen geht dem Beihilfeanspruch des Beamten, Richters, Soldaten, aber auch dem Anspruch auf Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch vor,
- – Leistungen der Anstaltspflege nach § 558 Abs. 2 Nr. 2 RVO, die der Unfallversicherungsträger nach Eintritt eines Arbeitsunfalles durch Gewährung von Unterhalt und Pflege in einer geeigneten Anstalt erbringt, sofern der Pflegebedürftige nicht widerspricht,
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 28 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
- – Leistungen bei stationärer Pflege nach § 35 Abs. 6 BVG (Übernahme der Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung einschließlich notwendiger Pflege unter Anrechnung der Versorgungsbezüge des Beschädigten) oder nach den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen.
4.2.3 Antragstellung
Die Beitragsfreiheit kommt nur auf Antrag des Mitglieds zustande. Der Antrag kann formlos gestellt werden. Mit dem Antrag muß allerdings der Nachweis erbracht werden, daß eine der vorgenannten zur Beitragsfreiheit führenden Entschädigungsleistungen bezogen wird. Der Antrag kann sich auch auf einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum beziehen.
4.3 Wirkung der Beitragsfreiheit
Die Beitragsfreiheit ist personenbezogen und wirkt sich daher auf alle dem Grunde nach beitragspflichtigen Einnahmen aus. Ändern sich die Verhältnisse, die für die Beitragsfreiheit erheblich sind, hat das Mitglied seine Pflegekasse darüber unverzüglich zu informieren (§ 50 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 SGB XI).
Die Pflegekasse teilt, sofern das Mitglied nicht selbst zahlungspflichtig ist, der zum Beitragsabzug verpflichteten Stelle mit, daß keine Beiträge mehr einzubehalten und abzuführen sind. In Bestandsfällen (Rentenbezug am 31. 12. 1994) sollte diese Mitteilung an den Rentenversicherungsträger mit dem als Anlage 1 beigefügten Vordruck vorgenommen werden.
Darüber hinaus teilt die Pflegekasse dem Rentenversicherungsträger die am 1. 1. 1995 nach § 56 Abs. 4 SGB XI beitragsfreien freiwilligen krankenversicherten Rentner mit. Dazu sollte ebenfalls der als Anlage 1 beigefügte Vordruck verwendet werden. Ist die zum Beitragseinbehalt verpflichtete Stelle nicht in der Lage, den Einbehalt einzustellen oder kann der Einbehalt von Beiträgen nur für die Zukunft unterbleiben, erstattet die Pflegekasse dem Mitglied die Beiträge; zu Unrecht gezahlte Beiträge aus Renten werden vom Rentenversicherungsträger erstattet. Eine Erstattung von Beiträgen kommt allerdings nur insoweit in Betracht, als die Beiträge noch nicht verjährt sind (vgl. § 27 Abs. 2 Satz 1 SGB IV).
IV Beitragspflichtige Einnahmen
1 Allgemeines
Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung sind die beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder. Das Recht der sozialen Pflegeversicherung übernimmt den auch im Bereich der Krankenversicherung verwendeten Begriff der beitragspflichtigen Einnahmen und knüpft diesen – durch Verweisung – inhaltlich weitgehend an die Vorschriften der gesetzlichen Krankenversicherung an.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 29 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Bei der Anwendung der Bestimmung des § 57 Abs. 1 SGB XI ist das Versicherungsverhältnis des Mitglieds in der sozialen Pflegeversicherung maßgebend. Da dieses Versicherungsverhältnis wiederum mit dem Versicherungsverhältnis in der Krankenversicherung übereinstimmt, kann eine Zuordnung der Vorschriften über die Beitragsbemessung nach den jeweils versicherten Personengruppen erfolgen.
Abweichend von den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bzw. des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte zählt auch das Krankengeld zu den beitragspflichtigen Einnahmen in der Pflegeversicherung.
2 Bemessungsgrundlage für Beschäftigte
2.1 Allgemeines
Für die Beitragsbemessung der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 in Verb. mit Satz 1 SGB XI versicherungspflichtig Beschäftigten werden analog dem Recht der Krankenversicherung die in § 226 Abs. 1 Satz 1 SGB V genannten beitragspflichtigen Einnahmen zugrunde gelegt (§ 57 Abs. 1 SGB XI). Wegen der Renten aus der Alterssicherung der Landwirte wird auf die Ausführungen unter VI 8 verwiesen.
Die in § 226 Abs. 2 SGB V genannte Einnahmeuntergrenze für die aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen zu bemessenen Beiträge gilt auch für den Bereich der Pflegeversicherung.
Hinsichtlich der Berechnung der Pflegeversicherungsbeiträge aus dem Arbeitsentgelt gelten die Beitragsberechnungs-Richtlinien des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 16. September 1975 entsprechend.
2.2 Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt
Für die beitragsrechtliche Behandlung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt gilt § 227 SGB V. Damit gelten auch die von den Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger verlauteten Grundsätze für die Ermittlung des beitragspflichtigen Teils des einmalig gezahlten Arbeitsentgelts sowie für die Ermittlung der anteiligen Jahresbeitragsbemessungsgrenzen für den Versicherungszweig der Pflegeversicherung.
Bei der Bildung der anteiligen Jahresbeitragsbemessungsgrenze werden alle im Laufe eines Kalenderjahres beitragspflichtigen Zeiten des Beschäftigungsverhältnisses (SV-Tage) ermittelt. Obwohl das Krankengeld in der sozialen Pflegeversicherung von Rechts wegen keine Beitragsfreiheit begründet, werden Zeiten, in denen ein Anspruch auf Krankengeld besteht, im Hinblick auf § 227 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SGB V und nicht zuletzt auch wegen der gebotenen Einheitlichkeit bei der Beitragsberechnung nicht als SV-Tage gewertet.
Eine Sonderregelung gilt für einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, das in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1995 gezahlt wird und aufgrund der „März-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 30 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Klausel“ des § 227 Abs. 4 SGB V dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum des vergangenen Kalenderjahres (1994) zuzuordnen ist. In diesen Fällen ist das einmalig gezahlte Arbeitsentgelt nicht mit Beiträgen zur Pflegeversicherung zu belegen, da für das Jahr 1994 keine SV-Tage in der Pflegeversicherung angesetzt werden können und somit die anteilige Jahresbeitragsbemessungsgrenze 0 DM ausmacht.
2.3 Bemessungsgrundlage während des Bezugs von Kurzarbeiter- oder Schlechtwettergeld
Da § 57 Abs. 1 SGB XI u. a. auf die Krankenversicherungs-Beitragsvorschriften der Empfänger von Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld (§ 163 Abs. 1 und 3 AFG) verweist, gilt als Bemessungsgrundlage für die Pflegeversicherungsbeiträge 80 v. H. des Arbeitsentgelts nach den §§ 68 und 86 AFG, vervielfacht mit der Zahl der Ausfallstunden, für die dem Arbeitnehmer Kurzarbeiter- oder Schlechtwettergeld gezahlt worden ist (= SV-Entgelt).
2.4 Besondere Beschäftigtengruppen
Die abweichenden Regelungen des § 232 SGB V hinsichtlich der Beitragsbemessungsgrenze für unständig Beschäftigte gelten ebenfalls für die Beiträge zur Pflegeversicherung.
Für Seeleute gilt als beitragspflichtige Einnahme das in § 233 SGB V genannte Durchschnittsentgelt.
Das Vorruhestandsgeld steht auch für die Bemessung der Pflegeversicherungsbeiträge wegen der generellen Verweisung in § 57 Abs. 1 SB XI dem Arbeitsentgelt gleich.
2.5 Fehlversicherung
Obwohl vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich genannt, gilt auch § 160 AFG für die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung entsprechend. Das bedeutet, daß der Arbeitgeber insoweit von seiner Verpflichtung, Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung zu entrichten, befreit wird, als er für den Zeitraum, für den die Bundesanstalt für Arbeit im Falle des § 117 Abs. 4 Satz 1 AFG Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung geleistet hat, diese Pflegeversicherungsbeiträge der Bundesanstalt erstattet.
3 Bemessungsgrundlage für AFG-Leistungsempfänger
Bei den nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 in Verb. mit Satz 1 SGB XI Versicherungspflichtigen gilt als beitragspflichtige Einnahme – wie in der Krankenversicherung – 80 v. H. des Arbeitsentgelts, das der Bemessung der Leistung zugrunde liegt (§ 157 Abs. 3 AFG). Ausgangsbasis ist damit auch in der Pflegeversicherung nicht das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt, sondern das nach den Leistungstabellen der AFG-Leistungsverordnung für die Höhe der gewährten Leistung maßgebende Arbeitsentgelt.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 31 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Die Besonderheiten in der Krankenversicherung hinsichtlich des Bemessungsentgelts der Empfänger von Eingliederungsgeld, Eingliederungshilfe sowie Vorruhestandsgeld nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets gelten auch für die Beitragsbemessung in der Pflegeversicherung.
4 Beiträge für pflichtversicherte landwirtschaftliche Unternehmen und mitarbeitende Familienangehörige
Für landwirtschaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familienangehörige, die als solche der Versicherungspflicht unterliegen, wird nach § 57 Abs. 3 SGB XI auf den Krankenversicherungsbeitrag, der aus dem Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft nach dem Beitragsbemessungsmaßstab „Arbeitsbedarf“ oder „anderer angemessener Maßstab“ (Flächenwert oder korrigierter Jahresarbeitswert) zu zahlen ist, ein Zuschlag erhoben. Die Höhe des Zuschlags ergibt sich aus dem Verhältnis des Beitragssatzes nach § 55 Abs. 1 SGB XI zu dem nach § 247 SGB V festgestellten durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung stellt die Höhe des Zuschlags zum 1. 1. jeden Jahres fest. Er gilt vom 1. 7. des laufenden Jahres bis zum 30. 6. des folgenden Kalenderjahres.
Bei der Ermittlung des Zuschlags wird in der Zeit vom 1. 1. 1995 bis zum 30. 6. 1995 von dem ab 1. 7. 1994 geltenden Beitragssatz nach § 247 SGB V ausgegangen; das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung stellt die Höhe des Zuschlags zum 1. 10. 1994 fest (Artikel 43 PflegeVG). Der Zuschlag beträgt infolgedessen für die Zeit vom 1. 1. 1995 bis zum 30. 6. 1995 in den alten Bundesländern 7,5 v. H.; für landwirtschaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familienangehörige, deren Leistungsansprüche nach § 28 Abs. 2 SGB XI halbiert sind, beträgt somit der Zuschlag für diese Zeit 3,75 v. H. In den neuen Bundesländern beträgt für die Zeit vom 1. 1. 1995 bis zum 30. 6. 1995 der volle Zuschlag 7,7 v. H. und der halbe Zuschlag 3,85 v. H.
Auf den Zuschlag finden die Vorschriften über die Beitragsfreiheit sowie die Tragung, Zahlung und Erstattung entsprechend Anwendung, die für den Beitrag zur landwirtschaftlichen Krankenversicherung gelten, zu dem der Zuschlag erhoben wird.
Die Beiträge in Höhe des Zuschlags werden außerhalb der Monatsberechnung gesondert nachgewiesen.
Aus dem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis des in § 3 Abs. 2 Nr. 1 KVLG 1989 genannten landwirtschaftlichen Unternehmers werden Beiträge zur Pflegeversicherung nicht erhoben; eine dem § 39 Abs. 4 KVLG 1989 entsprechende Regelung enthält das Pflege-Versicherungsgesetz nicht.
5 Bemessungsgrundlage für Künstler und Publizisten
Für die Beitragsbemessung der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 in Verb. mit Satz 1 SGB XI versicherungspflichtigen Künstler und Publizisten gilt § 234 SGB V entsprechend.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 32 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
6 Bemessungsgrundlage für Jugendliche, Rehabilitanden, Behinderte
Bei den nach § 20 Abs. 1 Nr. 5 in Verb. mit Satz 1 SGB XI versicherten Mitgliedern der Pflegeversicherung (Jugendliche) gilt für die Beitragsbemessung § 235 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 4 SGB V entsprechend. Bei den nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in Verb. mit Satz 1 SGB XI versicherten Mitgliedern (Teilnehmer an berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation sowie an Berufsfindung oder Arbeitserprobung) gilt § 235 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Abs. 4 SGB V; sofern diese Personen kein Übergangsgeld erhalten, gilt § 235 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 4 SGB V. Bei den nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 7 und 8 in Verb. mit Satz 1 SGB XI versicherten Mitgliedern (Behinderte) ist § 235 Abs. 3 und 4 SGB V entsprechend anzuwenden.
Bei gleichzeitigem Bezug von Übergangsgeld und Rente der gesetzlichen Rentenversicherung sind für die Beitragsbemessung sowohl die Rente als auch 80 v. H. des dem Übergangsgeld zugrunde liegenden Arbeitsentgelts zu berücksichtigen. Soweit Beiträge oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze einbehalten worden sind, gilt § 231 Abs. 2 SGB V entsprechend.
7 Bemessungsgrundlage für Studenten, Praktikanten, Auszubildende ohne Arbeitsentgelt
Für die Beitragsbemessung der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 9 und 10 in Verb. mit Satz 1 SGB XI Versicherungspflichtigen gilt § 236 SGB V.
8 Bemessungsgrundlage für Rentner
Die Beiträge der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 SGB XI versicherungspflichtigen Rentenbezieher bemessen sich – dem Recht der Krankenversicherung folgend – nach den §§ 237 und 238 SGB V. Für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI versicherungspflichtigen Altenteiler und für die nach § 14 Abs. 4 FELEG versicherungspflichtigen Bezieher von Produktionsaufgaberente oder Ausgleichsgeld gilt für die Beitragsbemessung § 45 KVLG 1989 (§ 57 Abs. 3 Satz 5 SGB XI, § 14 Abs. 4 FELEG).
Von der Beitragspflicht werden somit grundsätzlich auch Rentennachzahlungen erfaßt, da § 237 Satz 2 SGB V und § 45 KVLG 1989 u. a. § 228 Abs. 2 SGB V für entsprechend anwendbar erklärt. Demnach sind Nachzahlungen von Renten bei der Beitragsberechnung zur Pflegeversicherung zu berücksichtigen, soweit sie auf einen Zeitraum entfallen, in dem der Rentner Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung hatte.
In den Fällen des § 157 Abs. 4 AFG erstattet der Träger der Rentenversicherung für die Zeit des Erstattungsanspruchs der Bundesanstalt für Arbeit die von ihr gezahlten Beiträge zur Pflegeversicherung. Beiträge an die Krankenkasse zugunsten der Pflegeversicherung hat der Rentenversicherungsträger für diese Zeit nicht zu zahlen.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 33 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
9 Bemessungsgrundlage für Bezieher von Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld während medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen
Für Personen, deren Mitgliedschaft nach § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 192 Abs. 1 Nr. 3 SGB V erhalten bleibt, gilt für die Bemessung der vom Rehabilitationsträger zu entrichtenden Pflegeversicherungsbeiträge § 235 Abs. 2 SGB V entsprechend. Für landwirtschaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familienangehörige, deren Mitgliedschaft in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 KVLG 1989 erhalten bleibt und deshalb zugleich nach § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI den Fortbestand der Pflegeversicherung begründet, gelten die Ausführungen unter IV 4.
In den Fällen des § 157 Abs. 4 AFG erstattet der Rehabilitationsträger für die Zeit des Erstattungsanspruchs der Bundesanstalt die von ihr gezahlten Beiträge aus dem Übergangsgeld zur Pflegeversicherung. Beiträge an die Krankenkasse zugunsten der Pflegeversicherung hat der Rehabilitationsträger für diese Zeit nicht zu zahlen.
10 Bemessungsgrundlage für Bezieher von Krankengeld
10.1 Allgemeines
Nach § 57 Abs. 2 Satz 1 SGB XI gilt bei Beziehern von Krankengeld (einschließlich des Krankengeldes nach § 24 b Abs. 2 Satz 2 SGB V, § 45 SGB V, § 12 KVLG 1989 und § 164 AFG) als beitragspflichtige Einnahme 80 v. H. des Arbeitsentgelts, das der Bemessung des Krankengeldes zugrunde liegt (Regelentgelt), wobei als Regelentgelt höchstens ein Betrag bis zur kalendertäglichen Leistungsbemessungsgrenze der Krankenversicherung Berücksichtigung findet (Bemessungsentgelt). Erst danach ist eine Kürzung auf 80 v. H. des Bemessungsentgelts vorzunehmen (Bemessungsgrundlage).
Aufgrund des vorstehend beschriebenen Verfahrens zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage wird die Prüfung der Beitragsbemessungsgrenze in der Pflegeversicherung bei der Beitragsberechnung aus dem Krankengeld entbehrlich.
Nach ausdrücklicher Bestimmung in § 57 Abs. 2 Satz 2 SGB XI gilt auch für den Krankengeldbezug eines rentenversicherungspflichtigen mitarbeitenden Familienangehörigen eines landwirtschaftlichen Unternehmers als beitragspflichtige Einnahme 80 v. H. des Arbeitsentgelts, das der Bemessung des Krankengeldes zugrunde liegt.
Anders als bei der Beitragsbemessung der Bezieher von Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld (vgl. Ausführungen unter 9) ist bei einer Anpassung des Krankengeldes eine entsprechende Erhöhung des dem Krankengeld zugrunde liegenden Regelentgelts nicht vorgesehen.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 34 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
10.2 Krankengeld richtet sich nicht nach dem Regelentgelt
Sofern sich das Krankengeld nicht nach dem Regelentgelt richtet, ist für die Beitragsberechnung der dem Krankengeld zugrunde liegende Ausgangswert maßgebend.
Bei Leistungsempfängern, die das Krankengeld in Höhe der Leistung nach dem Arbeitsförderungsgesetz erhalten, gilt somit als Bemessungsgrundlage 80 v. H. des Arbeitsentgelts, nach dem die AFG-Leistung bemessen wurde. Ausgangsbasis für die Bemessung der Leistung ist allerdings nicht das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt, sondern das nach den Leistungstabellen der AFG-Leistungsverordnung für die Höhe der gewährten Leistung maßgebende Arbeitsentgelt. Hierbei handelt es sich um Wochenbeträge. Der kalendertägliche Betrag der Bemessungsgrundlage wird ermittelt, indem der in der Mitteilung über die Leistungsbewilligung angegebene wöchentliche Betrag auf 80 v. H. gekürzt und anschließend durch sieben dividiert wird. Das der Bemessung der AFG-Leistung zugrunde liegende Arbeitsentgelt erhöht sich jeweils nach Ablauf eines Jahres seit dem Ende des Bemessungszeitraumes (§ 112 a AFG). Vom Zeitpunkt der Anpassung an erhöht sich damit auch die Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Pflegeversicherung.
Beim Krankengeldbezug eines nicht rentenversicherungspflichtigen mitarbeitenden Familienangehörigen ist der Zahlbetrag der Leistung der Beitragsbemessung zugrunde zu legen (§ 57 Abs. 2 Satz 3 SGB XI).
10.3 Kürzung der Bemessungsgrundlage bei gleichzeitigem Bezug von Arbeitsentgelt
Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch sieht in § 57 Abs. 2 für den Fall, daß das Mitglied neben dem Krankengeld beitragspflichtiges Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung erhält, keine Regelung vor. Eine Anwendung dieser Vorschrift nach ihrem Wortlaut würde somit dazu führen, daß die aus dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt und der (ungekürzten) Bemessungsgrundlage für das Krankengeld insgesamt zu zahlenden Beiträge höher wären als in den Fällen der ausschließlichen Beitragszahlung aufgrund der Entgeltersatzleistung. Um in diesen Fällen eine „doppelte“ Beitragszahlung zu vermeiden, ist bei gleichzeitigem Bezug von beitragspfichtigem Arbeitsentgelt die Bemessungsgrundlage für das Krankengeld um das beitragspflichtige Arbeitsentgelt zu kürzen.
Da mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft, die nicht rentenversicherungspflichtig sind, im allgemeinen nur Kost und Wohnung als Sachbezüge und daneben regelmäßig ein Taschengeld – also kein Arbeitsentgelt – erhalten, ruht der Anspruch auf das pauschalierte Krankengeld nicht, wenn diese Leistungen während der Arbeitsfähigkeit vom Beginn der siebten Woche an weitergewährt werden; sie werden auch nicht auf das pauschalierte Krankengeld angerechnet.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 35 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
10.4 Krankengeld neben anderer Entgeltersatzleistung
Bei gleichzeitigem Bezug von Krankengeld neben einer anderen Entgeltersatzleistung wird das dem Krankengeld zugrunde liegende Entgelt nicht berücksichtigt. Das bedeutet, daß in solchen Fällen lediglich das der anderen Entgeltersatzleistung zugrunde liegende Arbeitsentgelt als Bemessungsgrundlage dient. Im Ergebnis wird dadurch erreicht, daß für den Krankengeld-Spitzbetrag keine Bemessungsgrundlage angesetzt wird.
10.5 Wegfall bzw. Kürzung des Krankengeldes bei Zubilligung von Rente
Die Beitragspflicht zur Pflegeversicherung hängt vom Bezug des Krankengeldes, also von der tatsächlichen Leistungsgewährung ab. Dieser tatsächliche Vorgang wird durch die rückwirkende Zubilligung einer der in § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V genannten Leistungen (Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, Vollrente wegen Alters) und dem damit einhergehenden Erstattungsanspruch nach § 103 SGB X nicht aufgehoben. Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Tages, an dem die Mitteilung über die Rentenbewilligung (Rentenmitteilung) bei der Krankenkasse eingeht. Hinsichtlich der Erstattung der Beiträge vgl. Verfahrensregelung unter IX.
Wird anstelle der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit oder der Vollrente wegen Alters eine der in § 50 Abs. 2 SGB V genannten Rentenleistungen rückwirkend zugebilligt und kommt es dadurch zu einer Änderung in der Leistungshöhe (Kürzung des Krankengeldes), so fällt auch der Rechtsgrund für die zu leistenden Beiträge im Umfang der Änderung weg. Vom Tage nach Eingang der Rentenmitteilung bei der Krankenkasse ist die um den Zahlbetrag der (Brutto-)Rentenleistung verminderte Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Beiträge maßgebend.
Beispiel
| Krankengeldbezug ab | 18. 4. 1995 | |
| Beginn der BU-Rente | 1. 5. 1995 | |
| Eingang Rentenmitteilung bei der Krankenkasse | 14. 11. 1995 | |
| Regelentgelt | 120 DM kalendertäglich | |
| Zahlbetrag des Krankengeldes | ||
| – bis 14. 11. 1995 | 90 DM kalendertäglich | |
| – ab 15. 11. 1995 | 50 DM kalendertäglich | |
| Zahlbetrag der (Brutto-)Rente | 40 DM kalendertäglich | |
| Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Pflegeversicherung | ||
| – bis 14. 11. 1995 (80 % von 120 DM =) |
96 DM | |
| – ab 15. 11. 1995 (80 % von 120 DM ./. 40 DM =) |
56 DM |
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 36 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
| Tragung der Beiträge Versicherter bis 14. 11. 1995 aus (90 DM : 2 =) |
45 DM |
| Krankenkasse bis 14. 11. 1995 aus (96 DM ./. 45 DM =) | 51 DM |
| Versicherter ab 15. 11. 1995 aus (50 DM : 2 =) | 25 DM |
| Krankenkasse ab 15. 11. 1995 aus (56 DM ./. 25 DM) | 31 DM |
Hinsichtlich der Erstattung der Beiträge für die Zeit vom Rentenbeginn bis zum Eingang der Rentenmitteilung vgl. Verfahrensregelung unter IX.
10.6 Sonderfälle
10.6.1 Beurteilung der Beitragspflicht in Fällen, in denen sich nachträglich herausstellt, daß kein Arbeitsunfall vorgelegen hat
Die aufgrund des Bezugs von Verletztengeld eingetretene Beitragspflicht des Unfallversicherungsträgers zur Pflegeversicherung wird in entsprechender Anwendung der Krankenversicherungs-Beitragspflicht rückwirkend beseitigt (vgl. Urteil des Bundessozialgerichts vom 12. 12. 1990 – 12 RK 35/89 – USK 9072), wenn sich nachträglich herausstellt, daß die Krankheit nicht Folge eines Arbeitsunfalles ist. Die in der irrtümlichen Annahme, es habe ein Arbeitsunfall vorgelegen, gezahlten Beiträge sind dem Unfallversicherungsträger zu erstatten.
10.6.2 Beurteilung der Beitragspflicht in Fällen, in denen sich nachträglich herausstellt, daß ein Arbeitsunfall vorgelegen hat
Sofern sich nachträglich herausstellt, daß die Krankheit Folge eines Arbeitsunfalles ist und somit rückwirkend die Leistungspflicht des Unfallversicherungsträgers eintritt, begründet das im Rahmen der Erstattung an die Stelle des Krankengeldes tretende Verletztengeld nach Meinung der Spitzenverbände der Krankenkassen Beitragspflicht zur Pflegeversicherung. Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung schließen sich dieser Auffassung allerdings nicht an. Sie sind der Meinung, daß sich ein Anspruch auf Pflegeversicherungsbeiträge – wie im übrigen auch auf Krankenversicherungsbeiträge – nicht herleiten läßt, da das vom Unfallversicherungsträger nach § 105 SGB X erstattete Krankengeld nicht rückwirkend in Verletztengeld umgewandelt wird, sondern als Krankengeld tatsächlich bezogen bleibt. Im Hinblick darauf, daß eine einvernehmliche Lösung nicht gefunden werden kann, wird die Klärung der Angelegenheit von Ausgang der Musterstreitfälle hinsichtlich der Beitragspflicht zur Krankenversicherung abhängig gemacht.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 37 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
11 Bemessungsgrundlage für freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung
Bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung, die nach § 20 Abs. 3 SGB XI der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung unterliegen, gilt gemäß § 57 Abs. 4 Satz 1 SGB XI für die Beitragsbemessung § 240 SGB V entsprechend. Danach hat die Satzung der Pflegekasse eine Regelung für die Beitragsbemessung vorzusehen, wobei sichergestellt werden muß, daß dabei die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Mitglieds berücksichtigt wird. Die Mindestbemessungsgrundlagen des § 240 Abs. 4 SGB V gelten auch für die Beiträge zur Pflegeversicherung.
Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Fach- oder Berufsfachschüler (die dort ebenfalls genannten Auszubildenden ohne Arbeitsentgelt und Praktikanten dürften in aller Regel der Krankenversicherungspflicht und dementsprechend auch der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung unterliegen) werden durch § 57 Abs. 4 Satz 3 SGB XI hinsichtlich der Beitragsbemessung den in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtigen Studenten und Praktikanten gleichgestellt. Für diese Personen gilt als beitragspflichtige Einnahme der in § 236 SGB V genannte Betrag (Bedarfssatz nach dem BAföG).
Als beitragspflichtige Einnahmen der freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten satzungsmäßigen Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnlichen Personen, gilt abweichend von § 57 Abs. 4 Satz 1 SGB XI der Wert für gewährte Sachbezüge oder das ihnen zur Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse an Wohnung und Verpflegung, Kleidung und dergleichen gezahlte Entgelt. Aus Vereinfachungsgründen kann für den Kalendertag der 180. Teil der monatlichen Bezugsgröße zugrunde gelegt werden.
Für Personen, die für die Dauer einer Beschäftigung im Ausland in der Krankenversicherung eine Anwartschaftsversicherung abgeschlossen haben, sind die Beiträge für den Kalendertag in Anlehnung an § 57 Abs. 5 SGB XI aus dem 180. Teil der monatlichen Bezugsgröße zu ermitteln.
Bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung, die von einem Rehabilitationsträger Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld erhalten, gilt als Bemessungsgrundlage 80 v. H. des Regelentgelts, das der Bemessung der Entgeltersatzleistung zugrunde liegt (§ 57 Abs. 4 Satz 4 SGB XI). Für die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherten sind in diesen Fällen die Beiträge vom zuständigen Leistungsträger nach Maßgabe der §§ 46 und 48 KVLG 1989 zu tragen und zu zahlen (§ 59 Abs. 1 Satz 1 und § 60 Abs. 1 Satz 1 SGB XI).
12 Bemessungsgrundlage für sonstige Versicherte
Für die Beitragsbemessung der nach § 21 SGB XI Versicherungspflichtigen gilt § 240 SGB V ebenfalls entsprechend (§ 57 Abs. 4 Satz 1 SGB XI).
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 38 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
13 Bemessungsgrundlage für Weiterversicherte
Bei Personen, die von ihrem Weiterversicherungsrecht nach § 26 Abs. 1 SGB XI Gebrauch gemacht haben, ist für die Beitragsbemessung § 240 SGB V entsprechend anzuwenden (§ 57 Abs. 4 Satz 1 SGB XI).
Der Beitragsbemessung von Personen, die nach § 26 Abs. 2 SGB XI weiterversichert sind, werden gemäß § 57 Abs. 5 SGB XI für den Kalendertag der 180. Teil der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB VI zugrunde gelegt.
14 Bemessungsgrundlage für Rentenantragsteller
Die beitragspflichtigen Rentenantragsteller, die nach § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 189 SGB V als Mitglieder gelten, werden in der Krankenversicherung bei der Beitragsbemessung wie freiwillige Mitglieder ohne Rentenbezug behandelt. § 57 Abs. 4 Satz 2 SGB XI verweist hinsichtlich der Bemessungsgrundlage auf § 239 SGB V. Damit gilt die für Rentenantragsteller maßgebende Beitragsbemessung auch für Personen, bei denen die Rentenzahlung eingestellt wird, bis zum Ablauf des Monats, in dem die Entscheidung über den Wegfall oder Entzug der Rente unanfechtbar geworden ist. Entsprechendes gilt für die beitragspfichtigen Antragsteller auf Renten aus der Alterssicherung der Landwirte, die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung nach § 23 KVLG 1989 versichert sind, sowie für die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung versicherten Antragsteller auf Produktionsaufgaberente oder Ausgleichsgeld nach dem FELEG; § 44 KVLG 1989 findet analog Anwendung.
15 Bemessungsgrundlage für Schwangere, deren Mitgliedschaft nach § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 192 Abs. 2 SGB V erhalten bleibt
Für Schwangere, deren Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft vom Arbeitgeber zulässig aufgelöst worden ist oder die unter Wegfall ihres Arbeitsentgelts beurlaubt worden sind, gelten für die Beitragsbemessung die Bestimmungen der Satzung der Pflegekasse (§ 57 Abs. 1 SGB XI in Verb. mit § 226 Abs. 3 SGB V bzw. § 42 Abs. 3 KVLG 1989).
16 Bemessungsgrundlage für Wehr- und Zivildienstleistende
Durch den Hinweis in § 57 Abs. 1 Satz 1 SGB XI auf § 244 SGB V gelten die Beitragsbemessungen der Wehr- und Zivildienstleistenden die in der Krankenversicherung maßgebenden Grundlagen. Danach wird der Beitrag zur Pflegeversicherung bei einer Einberufung zu einem Wehrdienst (Zivildienst) von länger als drei Tagen
- – auf ein Drittel des Beitrags ermäßigt, wenn das Arbeitsentgelt bei einem nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 in Verb. mit Satz 1 SGB XI Versicherungspflichtigen nach § 1 Abs. 2 Arbeitsplatzschutzgesetz weiterzugewähren ist,
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 39 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
- – auf ein Zehntel des Beitrags ermäßigt, der vor der Einberufung zuletzt zu entrichten war, wenn das Arbeitsentgelt eines nach § 20 SGB XI Versicherungspflichtigen während der Zeit des Wehrdienstes (Zivildienstes) nicht weitergewährt wird. Diese Beiträge werden – wie in der Krankenversicherung – pauschal berechnet. Die Verordnung über die pauschale Berechnung und die Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung für die Dauer eines aufgrund gesetzlicher Pflicht zu leistenden Dienstes (KV-Pauschalbeitragsverordnung) gilt entsprechend.
Für die aus Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen zu bemessenden Beiträge ist eine Beitragsermäßigung nicht vorgesehen.
Der Beitrag von Wehr- und Zivildienstleistenden, die bei Inkrafttreten des Gesetzes einberufen sind, bemißt sich entsprechend § 57 Abs. 1 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 244 SGB V nach dem Beitrag, der zu entrichten gewesen wäre, wenn die Pflegeversicherung zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden hätte (Artikel 44 PflegeVG).
V Beitragstragung
1 Krankenversicherungspflichtig Beschäftigte
Die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 in Verb. mit Satz 1 SGB XI versicherungspflichtig Beschäftigten und ihre Arbeitgeber tragen die nach dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beiträge grundsätzlich jeweils zur Hälfte (§ 58 Abs. 1 SGB XI). Die Beiträge aus den Versorgungsbezügen sowie aus dem Arbeitseinkommen trägt der versicherungspflichtige Beschäftigte alleine; die nach der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu bemessenden Beiträge tragen der Versicherte und der Rentenversicherungsträger jeweils zur Hälfte.
Liegt der Beschäftigungsort (§§ 9 und 10 SGB IV) des Arbeitnehmers jedoch in einem Land, in dem die am 31. 12. 1993 bestehende Anzahl der gesetzlichen landesweiten Feiertage nicht um einen Feiertag, der stets auf einen Werktag fiel, vermindert worden ist, trägt der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB XI versicherungspflichtig Beschäftigte die aus dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beiträge gemäß § 58 Abs. 3 SGB XI in voller Höhe.
Wird in der Rechtsverordnung nach Artikel 69 des Pflege-Versicherungsgesetzes festgestellt, daß zum Ausgleich der mit der Einführung der stationären Pflegeleistungen (ab 1. 7. 1996) verbundenen Beitragsmehrbelastungen der Arbeitgeber die Abschaffung eines weiteren Feiertages erforderlich ist, tragen in den Ländern, in denen ein weiterer landesweiter, stets auf einen Werktag fallender Feiertag abgeschafft worden ist, Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Beitrag je zur Hälfte. Liegt der Beschäftigungsort dagegen in einem Land, in dem nur ein Feiertag aufgehoben wurde, trägt der Beschäftigte den vom 1. 7. 1996 an zusätzlich zu entrichtenden Beitrag von 0,7 v. H. alleine (§ 58 Abs. 4 SGB XI).
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 40 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Wird in der Rechtsverordnung nach Artikel 69 des Pflege-Versicherungsgesetzes festgestellt, daß ein Ausgleichsbedarf nicht besteht, tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber den zusätzlichen Beitrag von 0,7 v. H. je zur Hälfte.
Die Aufhebung eines Feiertages wirkt für das gesamte Kalenderjahr. Wird die Aufhebung erst im Laufe des Kalenderjahres beschlossen und handelt es sich um einen Feiertag, der nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung für die Streichung liegt, wirkt die Aufhebung vom Beginn des Kalenderjahres der Streichung an. Die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung über die Streichung vom Arbeitnehmer getragenen Arbeitgeberanteile zur Pflegeversicherung sind dem Arbeitnehmer zu erstatten. Handelt es sich bei der Aufhebung eines Feiertages um einen Feiertag, der im laufenden Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung über der Streichung liegt, wirkt die Aufhebung erst im folgenden Kalenderjahr (§ 58 Abs. 5 SGB XI).
Die vom Grundsatz der hälftigen Beitragslastverteilung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern abweichenden Regelungen in der Krankenversicherung nach § 249 Abs. 2 und 3 SGB V und § 163 Abs. 2 AFG gelten über § 58 Abs. 6 SGB XI auch in der sozialen Pflegeversicherung.
2 Andere Pflichtversicherte in der Krankenversicherung
Für die Tragung der Beiträge der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 bis 11 SGB XI Versicherungspflichtigen gelten die §§ 249 a, 250 Abs. 1 und § 251 SGB V, §§ 47 und 48 KVLG 1989 sowie § 157 Abs. 1 AFG entsprechend (§ 59 Abs. 1 Satz 1 SGB XI). Demnach richtet sich die Beitragslastverteilung in der sozialen Pflegeversicherung nach den Vorschriften der gesetzlichen Krankenversicherung.
Dies bedeutet, daß
- – für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB XI versicherten Leistungsempfänger die Bundesanstalt,
- – für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI versicherungspflichtigen mitarbeitenden Familienangehörigen der landwirtschaftlichen Unternehmer,
- – für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB XI versicherungspflichtigen Künstler und Publizisten die Künstlersozialkasse,
- – für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB XI versicherungspflichtigen Jugendlichen der Träger der Einrichtung,
- – für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB XI versicherungspflichtigen Teilnehmer an berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation sowie an Berufsfindung oder Arbeitserprobung und für die Bezieher von Übergangsgeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld der zuständigen Rehabilitationsträger,
- – für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 SGB XI versicherungspflichtigen Behinderten, wenn das tatsächliche Arbeitsentgelt den nach § 235 Abs. 3
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 41 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
- SGB V maßgeblichen Mindestbetrag nicht übersteigt, der Träger der Einrichtung,
- – für die Wehr- und Zivildienstleistenden im Falle des § 193 Abs. 2 und 3 SGB V der Bund
die Beiträge trägt. Die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI versicherungspflichtigen landwirtschaftlichen Unternehmer zahlen ihre Beiträge allein.
Im übrigen werden die Beiträge
- – aus den Versorgungsbezügen,
- – aus dem Arbeitseinkommen,
- – aus den beitragspflichtigen Einnahmen nach § 57 Abs. 1 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 236 Abs. 1 SGB V
von den Mitgliedern getragen.
Die nach der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu bemessenden Beiträge tragen der Rentenversicherungsträger und der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 bis 11 SGB XI Versicherte jeweils zur Hälfte.
Bei Beziehern einer Rente aus der Alterssicherung der Landwirtschaft werden die Beiträge von den Beziehern dieser Rente und der landwirtschaftlichen Alterkasse je zur Hälfte getragen (§ 59 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). Dies gilt gleichermaßen für die Bezieher einer Produktionsaufgaberente nach dem FELEG, und zwar unabhängig davon, ob sie bei einer landwirtschaftlichen Krankenkasse nach § 14 Abs. 4 FELEG pfichtversichert und beitragspflichtig sind oder bei einer anderen Krankenkasse aus der Produktionsaufgaberente beitragspflichtig sind, sowie für nach § 14 Abs. 4 FELEG beitragspflichtige Bezieher von Ausgleichsgeld. Wegen der Bezieher von Ausgleichsgeld im Sinne des § 15 Abs. 4 FELEG (vgl. Ausführungen unter A II 4) gilt § 249 SGB V entsprechend mit der Maßgabe, daß der Bezieher des Ausgleichsgeldes und die landwirtschaftliche Alterskasse je zur Hälfte den Beitrag aus dem Ausgleichsgeld (der Bezug des Ausgleichsgeldes gilt als Bezug von Arbeitsentgelt) tragen (§ 15 Abs. 4 FELEG). Die landwirtschaftliche Alterskasse hat gegen den Beitragspflichtigen einen Anspruch auf den vom Versicherten zu tragenden Teil des Beitrages (§ 60 Abs. 1 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 256 SGB V, § 50 Abs. 2 KVLG 1989; § 60 Ab. 1 Satz 3 SGB XI).
3 Freiwillig Versicherte einer Krankenkasse
Nach § 59 Abs. 4 Satz 1 SGB XI tragen Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind (§ 20 Abs. 3 SGB XI), den Beitrag alleine.
Für satzungsgemäße Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnlichen Personen werden die Beiträge nicht nur in den Fällen der Weiterversicherung nach § 26 SGB XI von der Gemeinschaft getragen, sondern selbst dann, wenn eine freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, wie in § 59 Abs. 4 Satz 2 SGB XI durch das Wort „auch“ zum Ausdruck kommt.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 42 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Die Beiträge der freiwillig krankenversicherten Bezieher bestimmter Entgeltersatzleistungen, die sich nach § 57 Abs. 4 Satz 4 SGB XI bemessen, trägt – analog der Vorschrift des § 251 Abs. 1 SGB V – der zuständige Rehabilitationsträger alleine. Für die aufgrund einer freiwilligen Versicherung in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung nach § 20 Abs. 3 SGB XI Pflichtversicherten gelten die §§ 46 und 47 KVLG 1989 entsprechend.
4 Bezieher von Krankengeld
Die Beiträge der versicherten Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die Krankengeld beziehen, werden insoweit zur Hälfte getragen, als die Beiträge auf die Leistung (Zahlbetrag des Krankengeldes) entfallen. Der darüber hinausgehende Beitrag geht ausschließlich zu Lasten der Krankenkasse (§ 59 Abs. 2 SGB XI).
Bei einer Kürzung des Krankengeldes aufgrund der Zubilligung einer der in § 50 Abs. 2 SGB V genannten Rentenleistungen vermindert sich der Beitragsanteil des Versicherten vom Tage nach Eingang der Rentenmitteilung bei der Krankenkasse auf die Hälfte des gekürzten Krankengeldzahlungsbetrages.
Ansonsten gilt die auch für die Beiträge aus dem Krankengeld zur Rentenversicherung getroffene Regelung, wonach der Leistungsträger die Beiträge allein zu tragen hat, wenn das Krankengeld in Höhe der Leistung der Bundesanstalt für Arbeit gewährt wird oder das dem Krankengeld zugrundeliegende Arbeitsengelt (Regelentgelt) die Geringverdienergrenze nicht übersteigt.
Für die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung versicherten mitarbeitenden Familienangehörigen, die nicht rentenversicherungspflichtig sind, tragen der Leistungsträger und der Versicherte den Beitrag aus dem pauschalierten Krankengeld nach § 13 KVLG 1989 je zur Hälfte (§ 59 Abs. 2 SGB XI).
5 Sonstige Versicherte
Die Beiträge der nach § 21 Nrn. 1 bis 5 SGB XI Versicherten werden nach § 59 Abs. 3 Satz 1 SGB XI vom jeweiligen Leistungsträger getragen. Eine Beteiligung dieser Versicherten bei der Beitragsaufbringung ist aus sozialen Erwägungen nicht vorgesehen.
Nach § 59 Abs. 4 Satz 1 SGB XI tragen die der Versicherungspflicht nach § 21 Nr. 6 SGB XI unterstellten Soldaten auf Zeit den Beitrag alleine.
6 Rentenantragsteller und Schwangere, deren Mitgliedschaft erhalten bleibt
Die in § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 189 SGB V genannten Rentenantragsteller sowie Schwangere, deren Mitgliedschaft nach § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 192 Abs. 2 SGB V erhalten bleibt, tragen den Beitrag – wie in der Krankenversicherung – alleine (§ 59 Abs. 4 Satz 1 SGB XI).
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 43 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Dies gilt ebenso für die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung versicherten Antragsteller auf Rente aus der Alterssicherung der Landwirte sowie auf Produktionsaufgaberente oder Ausgleichsgeld nach § 14 Abs. 4 FELEG und die Schwangeren, deren Mitgliedschaft nach § 49 Abs. 2 SGB XI in Verb. mit § 25 Abs. 2 KVLG 1989 in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung erhalten bleibt.
7 Weiterversicherte
Die Personen, die von ihrem Recht der Weiterversicherung Gebrauch machen (§ 26 SGB XI), tragen den Beitrag nach § 59 Abs. 4 Satz 1 SGB XI grundsätzlich alleine. Dies gilt jedoch nicht für nach § 26 SGB XI weiterversicherte satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnliche Personen. In diesen Fällen trägt die Gemeinschaft die Beiträge (§ 59 Abs. 4 Satz 2 SGB XI).
VI Fälligkeit
Da auch die soziale Pflegeversicherung in den sachlichen Geltungsbereich des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – eingebunden ist, gilt hinsichtlich der Fälligkeit der Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung § 23 SGB IV.
Dies bedeutet, daß die Satzung der Kranken- und Pflegekassen den Fälligkeitstag für laufende Beiträge, die geschuldet werden, festlegt. Beiträge, die nach dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu bemessen sind, werden spätestens am Fünfzehnten des Monats fällig, der dem Monat folgt, in dem die Beschäftigung oder Tätigkeit, mit der das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt. Beiträge aus Versorgungsbezügen, die die Zahlstelle einzubehalten und an die Krankenkasse zu zahlen hat, werden fällig mit der Auszahlung der Versorgungsbezüge, von denen sie einzubehalten sind.
Die Fälligkeit der Beiträge zur Pflegeversicherung aus Entgeltersatzleistungen richtet sich nach § 23 Abs. 2 SGB IV.
VII Beitragszahlung
1 Allgemeines
Die Beiträge zur Pflegeversicherung sind nach § 60 Abs. 1 Satz 1 SGB XI grundsätzlich von denjenigen zu zahlen, die sie getragen haben. Sie gelten damit als Beitragsschuldner, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 44 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
2 Beitragszahlung aus dem Arbeitsentgelt
2.1 Gesamtsozialversicherungsbeitrag
Nach § 60 Abs. 1 Satz 2 SGB XI gelten für die Zahlung der Beiträge von versicherungspflichtig Beschäftigten (§ 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB XI) aus dem Arbeitsentgelt die Vorschriften über den Gesamtsozialversicherungsbeitrag nach den §§ 28 d bis 28 n und § 28 r SGB IV. Das dort näher beschriebene Verfahren und die Haftung bei der Beitragszahlung gilt – wie in der Krankenversicherung – nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für arbeitnehmerähnliche Personen wie
- – Bezieher von Vorruhestandsgeld (§ 20 Abs. 2 SGB XI),
- – Bezieher von Ausgleichsgeld nach § 15 Abs. 4 FELEG,
- – Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe (§ 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB XI),
- – Teilnehmer an berufsfördernden Maßnahmen (§ 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB XI) und
- – Behinderte in geschützten Einrichtungen (§ 20 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 7 und 8 SGB XI).
Die Vorschriften über den Gesamtsozialversicherungsbeitrag finden auf die nach § 20 Abs. 3 SGB XI Versicherungspflichtigen jedoch keine Anwendung, da nach dem Willen des Gesetzgebers in § 28 d Satz 2 SGB IV nur der Pflegeversicherungsbeitrag Gesamtsozialversicherungsbeitrag sein soll, der für einen in der gesetzlichen Krankenversicherung Pflichtversicherten gezahlt wird.
2.2 Zahlungspflicht
Die Einzahlung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge obliegt dem Arbeitgeber (§ 28 e Abs. 1 SGB IV).
Diese Verpflichtung trifft auch diejenigen, die als Arbeitgeber gelten oder die Pflichten des Arbeitgebers zu erfüllen haben (z. B. Einrichtungen der Jugendhilfe, Rehabilitationsträger, Träger der Einrichtung für Behinderte).
Hinsichtlich der Haftung bei Nichterfüllung der Zahlungspflichten gilt § 28 e Abs. 2 bis 5 SGB IV.
2.3 Aufzeichungs- und Nachweispflichten
In die vom Arbeitgeber für jeden Beschäftigten nach § 2 der Beitragsüberwachungsverordnung (BÜVO) zu führenden Lohnunterlagen sind vom 1. 1. 1995 an auch Angaben aufzunehmen über
- – den vom Arbeitnehmer zu tragenden (einbehaltenen) Anteil des Beitrags zur sozialen Pflegeversicherung,
- – die Befreiung von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung (Befreiungsbescheide).
Die für jeden Abrechnungszeitraum getrennt nach Einzugsstellen zu erstellende Beitragsabrechnung (§ 3 BÜVO) muß nunmehr auch die Beiträge zur
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 45 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
sozialen Pflegeversicherung – als Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags – ausweisen.
Durch Artikel 36 PflegeVG wird der amtliche Vordruck „Beitragsnachweis“ (Anlage 1 zur BÜVO) um die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung erweitert. Hierzu wird in den Vordruck eine Zeile mit der Bezeichnung „Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung“ eingefügt. Diese neue Beitragsgruppe erhält den Buchstaben „P“ sowie die Ziffernfolge „006“.
Darüber hinaus wird der Vordruck „Beitragsnachweis“ um die Beiträge zur Pflegeversicherung für freiwillig krankenversicherte Mitglieder ergänzt. Die Pflegeversicherungsbeiträge dieser Personen gelten nicht als Gesamtsozialversicherungsbeiträge (vgl. Ausführungen unter 2.1) und sind daher – sofern der Arbeitgeber die Zahlungspflicht freiwillig übernimmt – nur in dieser dafür vorgesehenen Zeile einzutragen.
Der Vordruck „Beitragsnachweis“ ist als Anlage 2 diesem Rundschreiben beigefügt.
2.4 Beitragszahlung im Rahmen der Konkursausfallgeldversicherung
Liegen bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers die Voraussetzungen des § 141 b Abs. 1 AFG (Konkurseröffnung) bzw. ein der Konkurseröffnung gleichgestelltes Insolvenzereignis (§ 141 b Abs. 3 Nr. 1 oder 2 AFG) vor, entrichtet das Arbeitsamt auf Antrag der Einzugsstelle künftig auch die für den Konkursausfallgeld-Zeitraum geschuldeten Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung, soweit das maßgebliche Insolvenzereignis nach Inkrafttreten des Pflege-Versicherungsgesetzes (1. 1. 1995) eintritt (Artikel 8 Nr. 4 PflegeVG). Der einschlägige Vordruck der Bundesanstalt für Arbeit (BA – Kaug5) wird der geänderten Rechtslage angepaßt. Das sonstige Verfahren bei der Entrichtung der Pflichtbeiträge im Rahmen des § 141 n AFG bleibt unberührt.
3 Beitragszahlung für AFG-Leistungsempfänger
Entsprechend dem in § 60 Abs. 1 Satz 1 SGB XI enthaltenen Grundsatz, wonach die Beiträge von denjenigen zu zahlen sind, die sie zu tragen haben, obliegt der Bundesanstalt für Arbeit die Pflicht zur Zahlung der Pflegeversicherungsbeiträge für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 in Verb. mit Satz 1 SGB XI Versicherten.
Die Bundesanstalt erstellt für die Beiträge zur Pflegeversicherung einen eigenen Beitragsnachweis.
4 Zahlung des Zuschlags für Mitglieder der landwirtschaftlichen Krankenkassen
Soweit für Mitglieder der landwirtschaftlichen Krankenkassen der Beitrag zur Pflegeversicherung als Zuschlag erhoben wird (insbesondere § 57 Abs. 3 SGB XI), gelten für die Zahlung des Zuschlags die Vorschriften über die Zah-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 46 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
lung des Krankenversicherungsbeitrages, zu dem der Zuschlag erhoben wird, entsprechend.
5 Beitragszahlung aus Entgeltersatzleistungen
5.1 Krankengeld
Für die Bezieher von Krankengeld zahlen die Krankenkassen die Beiträge (§ 60 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz SGB XI).
Hinsichtlich des Beitragsabzugs erklärt § 60 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB XI die Vorschrift des § 28 g Satz 1 SGB IV für entsprechend anwendbar. Dies bedeutet, daß die Krankenkasse bei Auszahlung des Krankengeldes den Beitragsanteil des Leistungsbeziehers einzubehalten hat. Die Einforderung des Beitragsanteils bei unterbliebenem Abzug unterliegt nicht den Einschränkungen der Sätze 2 und 3 des § 28 g SGB IV; mithin kann ein unterbliebener Einbehalt auch noch bei späteren Zahlungen nachgeholt werden. Die Einforderung des Beitragsanteils ist selbst dann möglich, wenn das Krankengeld nicht mehr gezahlt wird. Im übrigen geht der Einbehalt des Versichertenbeitragsanteils einer Aufrechnung, Verrechnung, Abtretung oder Pfändung vor.
Die Beiträge werden außerhalb der Monatsberechnung nachgewiesen.
5.2 Verletztengeld und Übergangsgeld der Unfallversicherung
Die Pflegeversicherungsbeiträge, die aus dem Verletztengeld oder dem Übergangsgeld der Unfallversicherung berechnet werden, trägt und zahlt grundsätzlich der zuständige Unfallversicherungsträger.
Soweit den Krankenkassen die Berechnung und Auszahlung des Verletztengeldes aufgrund der Verwaltungsvereinbarung über die generelle Beauftragung der Krankenkassen durch die Träger der Unfallversicherung zur Berechnung und Auszahlung des Verletztengeldes nach Maßgabe von § 1501 RVO und §§ 88 ff. SGB X (VV Generalauftrag Verletztengeld) obliegt, übernehmen sie auch die Feststellung der Beitragspflicht zur Pflegeversicherung (§ 57 Abs. 1 SGB XI in Verb. mit § 235 Abs. 2 SGB V bzw. § 48 Abs. 2 KVLG 1989) und die Berechnung und Abführung der vom Unfallversicherungsträger zu entrichtenden Beiträge.
In den Fällen, in denen der Krankenkasse die Berechnung oder Auszahlung des Verletztengeldes oder Übergangsgeldes aufgrund eines Einzelauftrags übertragen ist, übernehmen sie
- – bei Auszahlung von Verletztengeld die Feststellung der Beitragspflicht zur Pflegeversicherung (§ 57 Abs. 1 SGB XI in Verb. mit § 235 Abs. 2 SGB V bzw. § 48 Abs. 2 KVLG 1989) und die Berechnung und Abführung der vom Unfallversicherungsträger zu entrichtenden Beiträge,
- – bei Auszahlung von Übergangsgeld die Feststellung der Versicherungspflicht zur Pflegeversicherung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in Verb. mit Satz 1 SGB XI und die Berechnung und Abführung der vom Unfallversi-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 47 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
- cherungsträger zu entrichtenden Pflegeversicherungsbeiträge nach § 57 Abs. 1 SGB XI in Verb. mit § 235 Abs. 1 SGB V bzw. § 48 Abs. 2 KVLG 1989.
Die Verwaltungsvereinbarung über die Beauftragung der Krankenkassen durch die Träger der Unfallversicherung zur Berechnung und Abführung der Beiträge für die Bezieher von Verletzten- oder Übergangsgeld aus der Unfallversicherung nach Maßgabe von § 1501 RVO und §§ 88 ff. SGB X (VV Beiträge) wird aus diesem Grunde entsprechend erweitert.
Die Krankenkasse fordert die vom Unfallversicherungsträger zu entrichtenden Pflegeversicherungsbeiträge – gemeinsam mit den Krankenversicherungsbeiträgen – monatlich vom zuständigen Unfallversicherungsträger an (vgl. Abschnitt 2 Abs. 1 VV Beiträge).
5.3 Versorgungskrankengeld
Die aus dem Versorgungskrankengeld zu entrichtenden Pflegeversicherungsbeiträge zahlt nach § 60 Abs. 1 Satz 1 in Verb. mit § 59 Abs. 1 Satz 1 SGB XI und § 251 Abs. 1 SGB V der zuständige Rehabilitationsträger (hier: Verwaltungsbehörde).
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung berechnet jedoch die Krankenkasse – neben den Beiträgen zur Krankenversicherung – auch die Beiträge zur Pflegeversicherung und stellt diese der Verwaltungsbehörde in Rechnung.
5.4 Übergangsgeld der Rentenversicherung
Der zuständige Rentenversicherungsträger zahlt grundsätzlich die aus dem Übergangsgeld der Rentenversicherung von ihm zu tragenden Pflegeversicherungsbeiträge.
Berechnet die Krankenkasse jedoch im Auftrag des Rentenversicherungsträgers neben den Beiträgen zur Krankenversicherung auch die Beiträge zur Pflegeversicherung, werden diese in der Monatsberechnung Teil B Pos. 5.5 (Pflegeversicherungsbeiträge für Rehabilitanden) mit den an die Rentenversicherungsträger weiterzuleitenden Beiträgen verrechnet.
5.5 Übergangsgeld der Bundesanstalt
Die Pflegeversicherungsbeiträge aus dem Übergangsgeld werden von der Bundesanstalt für Arbeit zusammen mit den Beiträgen für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 in Verb. mit Satz 1 SGB XI Versicherten gezahlt.
5.6 Zuschlag für Mitglieder der landwirtschaftlichen Krankenkassen
Für die landwirtschaftlichen Unternehmer und mitarbeitenden Familienangehörigen (vgl. Ausführungen unter A II 2.5) sowie für die freiwilligen Mitglieder der landwirtschaftlichen Krankenkassen findet § 48 Abs. 2 KVLG 1989 entsprechend Anwendung (§ 59 Abs. 1 Satz 1 SGB XI). Das bedeutet, daß der Rehabilitationsträger den Zuschlag zur Krankenversicherung für die
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 48 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Pflegeversicherung (vgl. Ausführungen unter IV 4) zu tragen und zu zahlen hat, solange er Übergangsgeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld zahlt; der Zuschlag ist auch für die Zeit zu zahlen, in der die Pflegeversicherung nach § 49 Abs. 2 Satz 1 SGB XI in Verb. mit § 25 Abs. 1 Nr. 2 KVLG 1989 (vgl. Ausführungen unter B II 3) fortbesteht. Die Beiträge in Höhe des Zuschlages werden außerhalb der Monatsberechnung gesondert nachgewiesen.
6 Beitragszahlung aus der Rente
Hinsichtlich der Beitragszahlung aus der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung gilt § 255 SGB V entsprechend (§ 60 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). Danach hat der Träger der Rentenversicherung die Beiträge für die nach § 20 Abs. 1 SGB XI Versicherungspflichtigen, die sie aus ihrer Rente zu tragen haben, zusammen mit dem Beitragsanteil des Rentenversicherungsträgers an die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zugunsten der Pflegeversicherung zu zahlen. Dies gilt – abweichend von der besonderen Regelung für die landwirtschaftlichen Krankenkassen-Beiträge in § 50 Abs. 1 Satz 1 letzter Satzteil KVLG 1989 – auch für die Beiträge aus der Rente, für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI versicherungspflichtigen landwirtschaftlichen Unternehmen, mitarbeitenden Familienangehörigen und Altenteiler und die Antragsteller auf Rente aus der Alterssicherung der Landwirte sowei auf Produktionsaufgaberente oder Ausgleichsgeld nach § 14 Abs. 4 FELEG.
7 Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen
Für die nach § 20 Abs. 1 SGB XI Versicherungspflichtigen (mit Ausnahme der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB XI Versicherten), die eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, haben die Zahlstellen der Versorgungsbezüge die Beiträge zur Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen einzubehalten und an die zuständige Krankenkasse zu zahlen.
Ansonsten gilt § 256 SGB V wegen der Verweisung in § 60 Abs. 1 Satz 2 SGB XI auch – vorbehaltlich der Ausführungen unter 8 – für die Beiträge zur Pflegeversicherung. Hierzu wird auf die Verfahrensbeschreibung der Beitragsabführung zur Kranken- und Pflegeversicherung durch die Zahlstellen von Versorgungsbezügen (Zahlstellen-Verfahren) vom 13. Oktober 1994 verwiesen.
Die aus einer Rente aus der Alterssicherung der Landwirte sowie die aus einer Produktionsaufgaberente oder aus Ausgleichsgeld nach dem FELEG zu zahlenden Beiträge werden von der landwirtschaftlichen Altersklasse als Zahlstelle gezahlt (§ 60 Abs. 1 Satz 3 SGB XI).
Der Beitragsnachweis (lfd. Nr. 8 der Verfahrensbeschreibung) muß neben dem Beitrag und dem Beitragssatz zur Krankenversicherung auch den Beitrag und den Beitragssatz zur Pflegeversicherung ausweisen. Ebenso muß die
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 49 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Beitragsliste (lfd. Nr. 9 der Verfahrensbeschreibung) neben dem Beitrag je Versorgungsempfänger zur Krankenversicherung auch den Beitrag zur Pflegeversicherung beinhalten. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können in einer Summe an die zuständigen Krankenkasse überwiesen werden (lfd. Nr. 10 der Verfahrensbeschreibung).
8 Beitragszahlung aus Rente aus der Alterssicherung der Landwirte, Produktionsaufgaberente und Ausgleichsgeld
Die von einer Rente aus der Alterssicherung der Landwirte oder von einer Produktionsaufgaberente nach dem FELEG oder einem nach § 14 Abs. 4 FELEG beitragspflichtigen Ausgleichsgeld zu entrichtenden Beiträge werden – abweichend vom Recht der Krankenversicherung – je zur Hälfte vom Versicherten und der landwirtschaftlichen Alterskasse getragen (vgl. Ausführungen unter V 2). Die Beitragsanteile der landwirtschaftlichen Alterkassen trägt der Bund. Dementsprechend bestimmt § 60 Abs. 1 Satz 3 SGB XI, daß die landwirtschaftliche Altersklasse die Beiträge aus diesen Bezügen an die Pflegekasse abzuführen hat. Eine abweichende Vereinbarung im Sinne des § 256 Abs. 2 Satz 5 SGB V ist nicht möglich; die Rente aus der Alterssicherung der Landwirte sowie die Produktionsaufgaberente nach dem FELEG und das nach § 14 Abs. 4 FELEG beitragspflichtige Ausgleichsgeld werden insoweit den Renten der gesetzlichen Rentenversicherung gleichgestellt. Bei Bezug von mehreren Versorgungsbezügen gilt § 256 Abs. 1 Satz 4 SGB V entsprechend.
VIII Beitragseinzug
1 Gesamtsozialversicherungsbeitrag
1.1 Einzugsstelle
Der Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung, der als Gesamtsozialversicherungsbeitrag gezahlt wird, ist nach § 28 h Abs. 1 Satz 1 SGB IV an die Krankenkassen (Einzugsstellen) zu zahlen. Die Einzugsstelle entscheidet damit auch über die Versicherungspflicht und die Beitragshöhe in der Pflegeversicherung.
Zuständige Einzugsstelle ist die Krankenkasse im Sinne des § 28 i SGB IV.
1.2 Weiterleitung von Beiträgen
Die Krankenkasse, die als Einzugsstelle fungiert, leitet der bei ihr errichteten Pflegekasse die für diese gezahlten Beiträge einschließlich Zinsen auf Beiträge und Säumniszuschläge arbeitstäglich weiter (vgl. § 28 k Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz SGB IV).
Hinsichtlich der Weiterleitung und Abrechnung durch die Einzugsstelle gilt der Zweite Abschnitt der Verordnung übe die Zahlung, Weiterleitung, Ab-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 50 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
rechnung und Abstimmung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags (Beitragszahlungsverordnung). Abweichend von der Verpflichtung der Einzugsstelle in § 3 Abs. 1 Satz 1 der Beitragszahlungsverordnung, an jedem Arbeitstag Aufträge zur Überweisung der nach § 28 k Abs. 1 SGB IV weiterzuleitenden Beiträge zu erteilen, hat die Krankenkasse ein anderes Verfahren anzuwenden, wenn es für die Pflegekasse wirtschaftlicher ist (§ 3 Abs. 1 a der Beitragszahlungsverordnung).
1.3 Vergütung
Eine im Rahmen des § 28 l SGB IV an die Einzugsstelle zu leistende Vergütung für die Geltendmachung der Beitragsansprüche sowie den Einzug, die Verwaltung, Weiterleitung und Abrechnung der Beiträge zur Pflegeversicherung durch die Pflegekasse ist nicht vorgesehen. Diese Aufwendungen werden der Krankenkasse durch die Verwaltungskostenpauschale der Pflegekasse (§ 46 Abs. 3 SGB XI) abgegolten.
2 Übrige Beiträge
2.1 Zuständige Krankenkasse
Die Beiträge zur Pflegeversicherung, die nicht Gesamtsozialversicherungsbeiträge sind, sind an die Krankenkasse, bei der die zuständige Pflegekasse errichtet ist, zugunsten der Pflegeversicherung zu zahlen (§ 60 Abs. 3 Satz 1 SGB XI). Das gilt selbst für die Beiträge der Versicherten, die nicht Mitglieder der Krankenkasse, jedoch Mitglieder der Pflegekasse sind.
2.2 Weiterleitung
Die nach § 60 Abs. 3 Satz 1 SGB XI eingegangenen Beiträge zur Pflegeversicherung sind nach § 60 Abs. 3 Satz 2 SGB XI von der Krankenkasse unverzüglich an die Pflegekasse weiterzuleiten.
IX Erstattung von Beiträgen aus dem Krankengeld bei rückwirkender Zubilligung von Rente
1 Allgemeines
Die Beitragspflicht zur Pflegeversicherung hängt vom Bezug des Krankengeldes, also von der tatsächlichen Leistungsgewährung ab (vgl. Ausführungen unter IV 10.5). Dieser tatsächliche Vorgang wird durch die rückwirkende Zubilligung von Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, Vollrente wegen Alters oder einer der in § 50 Abs. 2 SGB V genannten Rentenleistungen und dem damit einhergehenden Erstattungsanspruch nach § 103 SGB X nicht aufgehoben. Das bedeutet andererseits jedoch nicht, daß diese Beiträge der Pflegekasse verbleiben. Der Rückerstattungsanspruch nach § 26 Abs. 2 SGB IV knüpft nämlich nicht an den tatsächlichen Leistungsbezug und die allein hieran ge-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 51 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
knüpfte Beitragsentrichtung, sondern an die Rechtmäßigkeit des Leistungsbezuges als Grundlage für die entrichteten Beiträge an. Wird der unrechtmäßige Leistungsbezug bei rückwirkender Zubilligung einer der obengenannten Rentenarten rückgängig gemacht, so entfällt auch rückwirkend die Rechtsgrundlage für die Beitragsentrichtung.
2 Erstattungszeitraum
Die infolge rückwirkender Zubilligung von Erwerbsunfähigkeitsrente einschließlich der Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit, Vollrente wegen Alters, Berufsunfähigkeitsrente einschließlich der Berufsunfähigkeit auf Zeit sowie der übrigen in § 50 Abs. 2 SGB V genannten Rentenleistungen zu Unrecht gezahlten Beiträge zur Pflegeversicherung werden unter Beachtung der Vorschriften über die Verjährung erstattet. Der Erstattungszeitraum deckt sich mit dem Zeitraum, für den das mit Beiträgen belegte Krankengeld infolge der rückwirkenden Rentenzubilligung wegfällt bzw. gekürzt wird (zeitliche Kongruenz).
3 Höhe der Beitragserstattung
3.1 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, Vollrente wegen Alters
Die Beiträge zur Pflegeversicherung werden wegen fehlender Rechtmäßigkeit des gesamten Leistungsbezugs (Wegfall des Krankengeldes) in voller Höhe erstattet, und zwar selbst dann, wenn dem Versicherten ein Spitzbetrag verbleibt, der von der Krankenkasse nicht zurückgefordert werden kann (vgl. § 50 Abs. 1 Satz 2 SGB V).
3.2 Rente wegen Berufsunfähigkeit sowie die übrigen in § 50 Abs. 2 SGB V genannten Rentenleistungen
Durch die rückwirkende Zubilligung einer dieser Renten und der damit verbundenen Kürzung des Krankengeldes fällt auch rückwirkend der Rechtsgrund für die geleisteten Beiträge im Umfang der Änderung weg. Erstattet werden somit die auf den Netto-Rentenbetrag (Rente abzüglich KVdR-Beitragsanteil) entfallenden Beiträge. War der Versicherte an der Beitragsaufbringung beteiligt, erhält er die Hälfte des Gesamtbetrags der Erstattung. Damit wird im Ergebnis erreicht, daß er für den Erstattungszeitraum die Beiträge nur in der Höhe trägt, soweit sie auf den verbleibenden Krankengeldzahlbetrag entfallen.
3.3 Vorgezogenes Übergangsgeld
Bei rückwirkender Zubilligung von vorgezogenem Übergangsgeld können die aufgrund des Bezugs von Krankengeld gezahlten Pflegeversicherungsbeiträge in voller Höhe erstattet werden, ungeachtet eines eventuell verbleiben-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 52 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
den Krankengeld-Spitzbetrages, da dieser wiederum keine Beitragspflicht zur Pflegeversicherung auslöst (vgl. Ausführungen unter IV 10.4).
Es gilt jeweils der Beitragssatz, der für den Erstattungszeitraum maßgebend war.
4 Verrechnung der Erstattungsbeträge
Die erstatteten Pflegeversicherungsbeiträge werden mit den im laufenden Monat nach § 60 Abs. 2 Satz 1 SGB XI (außerhalb der Monatsberechnung) abzuführenden Pflegeversicherungsbeiträgen verrechnet. Soweit der zu verrechnende Betrag den Betrag der für den laufenden Monat abzuführenden Pflegeversicherungsbeiträge für die Bezieher von Krankengeld übersteigt, erfolgt eine Überweisung des Restbetrages durch die Pflegekasse.
5 Erstattung der Versichertenanteile
Soweit die Pflegeversicherungsbeiträge auch vom Versicherten mitgetragen worden sind, fordert die Krankenkasse den Versichertenanteil ebenfalls zurück, da sie gewährleistet, daß der Versicherte oder, falls der Versicherte zwischenzeitlich verstorben ist, seine Erben den Anteil zurückerhalten.
6 Nachweis der Erstattungsbeträge
Die Krankenkasse führt neben dem Nachweis für die aus dem Krankengeld zu zahlenden Pflegeversicherungsbeiträge einen Nachweis über die erstatteten bzw. verrechneten Beiträge.
E Beitragszuschüsse
1 Allgemeines
Durch die Gewährung von Zuschüssen zu den Beiträgen zur Pflegeversicherung wird erreicht, daß der Grundsatz der hälftigen Aufteilung der Beitragslast zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch dann gilt, wenn der Arbeitnehmer seine Zahlungspflicht selbst zu erfüllen hat, sei es wegen einer freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung oder weil ein Pflege-Pflichtversicherungsschutz bei einem privaten Versicherungsunternehmen besteht.
Ansprüche auf Beitragszuschüsse haben neben dem Kreis der Arbeitnehmer und arbeitnehmerähnlichen Personen auch weitere Personengruppen, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei einem privaten Versicherungsunternehmen versichert sind.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 53 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
2 Freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer
2.1 Voraussetzungen für die Gewährung des Beitragszuschusses
Arbeiter und Angestellte, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind, erhalten unter den Voraussetzungen des § 58 SGB XI von ihrem Arbeitgeber nach § 61 Abs. 1 Satz 1 SGB XI einen Zuschuß zu ihrem Pflegeversicherungsbeitrag. Die Regelung entspricht inhaltlich weitgehend dem § 257 Abs. 1 SGB V. Obwohl der Anspruch auf den Beitragszuschuß zu den Krankenversicherungsbeiträgen daran geknüpft ist, daß der Beschäftigte nur wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei und freiwillig krankenversichert ist, die Vorschrift des § 61 Abs. 1 Satz 1 SGB XI für den Zuschuß zur Pflegeversicherung dieses Erfordernis formell nicht verlangt, kommt es hinsichtlich des anspruchsberechtigten Personenkreises zu keinen Abweichungen zwischen Kranken- und Pflegeversicherung.
Zu den anspruchsberechtigten Arbeitnehmern zählen auch die Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften bzw. von großen Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit.
Freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, erhalten keinen Beitragszuschuß von ihrem Dienstherrn. An die Stelle des Zuschusses tritt in diesen Fällen die Beihilfe oder Heilfürsorge des Dienstherrn zu den Aufwendungen aus Anlaß der Pflege.
2.2 Höhe des Beitragszuschusses
Als Zuschuß ist der Betrag zu zahlen, der als Arbeitgeberanteil nach § 58 SGB XI zu zahlen wäre. Sofern der Beschäftigungsort des Arbeitnehmers in einem Bundesland liegt, das keinen Feiertag abgeschafft hat, besteht kein Anspruch auf einen Zuschuß.
Für den Fall, daß innerhalb desselben Zeitraumes mehrere Beschäftigungsverhältnisse bestehen (Mehrfachbeschäftigte), trifft § 61 Abs. 1 Satz 2 SGB XI eine Regelung. Danach sind die beteiligten Arbeitgeber anteilig nach dem Verhältnis der Höhe der jeweiligen Arbeitsentgelte zur Zahlung des Beitragszuschusses verpflichtet.
3 Privat krankenversicherte Arbeitnehmer
3.1 Voraussetzungen für die Gewährung des Beitragszuschusses
Arbeiter und Angestellte, die nach § 23 SGB XI verpflichtet sind, bei einem privaten Versicherungsunternehmen zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit einen Versicherungsvertrag abzuschließen und aufrechtzuerhalten, erhalten unter den Voraussetzungen des § 58 SGB XI von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuß zu ihrem Pflegeversicherungsbeitrag (§ 61
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 54 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Abs. 2 Satz 1 SGB XI). Gleiches gilt auch für die Arbeiter und Angestellten, die sich nach § 22 SGB XI oder nach Artikel 41 PflegeVG von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung haben befreien lassen.
Arbeitnehmer, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben und bei einem privaten Versicherungsunternehmen pflegeversichert sind, erhalten keinen Beitragszuschuß von ihrem Dienstherrn. Für diese Personen tritt nach § 61 Abs. 8 Satz 1 SGB XI an die Stelle des Beitragszuschusses die Beihilfe oder Heilfürsorge des Dienstherrn zu den Aufwendungen aus Anlaß der Pflege.
3.2 Voraussetzungen des Versicherungsunternehmens
Der Zuschuß wird nach § 61 Abs. 6 SGB XI für eine private Pflegeversicherung nur dann gezahlt, wenn das Versicherungsunternehmen
- – die Pflegeversicherung nach Art der Lebensversicherung betreibt,
- – sich verpflichtet, den überwiegenden Teil der Überschüsse, die sich aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft ergeben, zugunsten der Versicherten zu verwenden,
- – die Pflegeversicherung nur zusammen mit der Krankenversicherung, nicht zusammen mit anderen Versicherungssparten betreibt.
Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber seine Zuschußberechtigung durch Vorlage einer Versicherungsbescheinigung nachzuweisen. Diese darf nur dann ausgestellt werden, wenn die zuständige Aufsichtsbehörde dem Versicherungsunternehmen bestätigt hat, daß es die Versicherung, die Grundlage des Versicherungsvertrages ist, nach den vorgenannten Voraussetzungen betreibt (§ 61 Abs. 7 SGB XI).
3.3 Höhe des Beitragszuschusses
Als Beitragszuschuß ist nach § 61 Abs. 2 Satz 2 SGB XI der Betrag zu zahlen, der als Arbeitgeberanteil nach § 58 SGB XI bei Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung zu zahlen wäre. Der Zuschuß ist allerdings begrenzt auf die Hälfte des Beitrags, den der Beschäftigte für seine private Pflegeversicherung zu zahlen hat. Sofern der Beschäftigungsort des Arbeitnehmers in einem Bundesland liegt, das keinen Feiertag abgeschafft hat, besteht kein Anspruch auf einen Zuschuß.
Bei Mehrfachbeschäftigung ist nach § 61 Abs. 2 Satz 3 SGB XI hinsichtlich der Zahlung des Beitragszuschusses eine der Höhe der jeweiligen Arbeitsentgelte entsprechende Aufteilung vorzunehmen.
4 Landwirtschaftliche Unternehmer
Aufgrund Artikel 11 Nr. 3 des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen Sicherung (Agrarsozialreformgesetz 1995 – ASRG 1995) vom 29. 7. 1994 ist die Regelung über den Beitragszuschuß landwirtschaftlicher Unternehmer nach § 61 Abs. 3 SGB XI gegenstandslos.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 55 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
5 Bezieher von Vorruhestandsgeld und ähnlichen Leistungen
5.1 Voraussetzungen für die Gewährung des Beitragszuschusses
Bezieher von Vorruhestandsgeld haben nach § 61 Abs. 4 Satz 1 SGB XI gegen den zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten Anspruch auf einen Zuschuß zu den Pflegeversicherungsbeiträgen, wenn ein solcher Anspruch (gemeint ist der Anspruch nach § 61 Abs. 1 oder 2 SGB XI) bereits unmittelbar vor Beginn der Vorruhestandsleistungen bestanden hat. Der Anspruch auf den Beitragszuschuß besteht auch in den Fällen, in denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Pflege-Versicherungsgesetzes bereits Vorruhestandsleistungen bezogen werden, sofern der Leistungsbezieher bei Beginn dieser Leistungen den Anspruch auf den Zuschuß hätte geltend machen können, wenn die Pflegeversicherung zu diesm Zeitpunkt bereits bestanden hätte.
Einen Anspruch auf Zuschuß zu den Beiträgen zur Pflegeversicherung haben auch
- – Bezieher von Leistungen nach § 9 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 AAÜG (Leistungen, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung überführt wurden, mit Ausnahme der Ansprüche auf Elternrenten) und
- – Bezieher einer Übergangsversorgung nach § 7 des Tarifvertrages über einen sozialverträglichen Personalabbau im Bereich des Bundesministers der Verteidigung vom 30. 11. 1991
für die Dauer der Leistungen. Bei Beziehern dieser Leistungen ist es für die Zuschußgewährung nicht erforderlich, daß ein Anspruch auf den vollen oder anteiligen Beitragszuschuß bis unmittelbar vor Beginn der Leistungen bestand.
5.2 Höhe des Beitragszuschusses
Als Zuschuß ist der Betrag zu zahlen, den der Bezieher von Vorruhestandsgeld oder ähnlichen Leistungen als versicherungspflichtiges Mitglied nach § 20 Abs. 2 SGB XI zu tragen hätte, höchstens jedoch die Hälfte des Beitrags, den er für seine Pflegeversicherung tatsächlich aufwendet (§ 61 Abs. 4 Satz 2 SGB XI).
6 Teilnehmer an berufsfördernden Maßnahmen
6.1 Voraussetzungen für die Gewährung des Beitragszuschusses
Die Vorschrift des § 61 Abs. 5 Satz 1 SGB XI räumt den Teilnehmern an berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation sowie an Berufsfindung oder Arbeitserprobung, die nach § 23 SGB XI zum Abschluß eines privaten Pflegeversicherungsvertrages verpflichtet sind, gegen den zuständigen Leistungsträger einen Anspruch auf Zuschuß zu den Pflegeversicherungsbeiträgen ein. Hinsichtlich der von den Versicherungsunternehmen zu erfüllenden Voraussetzungen wird auf die Ausführungen unter 3.2 verwiesen.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 56 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
6.2 Höhe des Beitragszuschusses
Als Zuschuß ist nach § 61 Abs. 5 Satz 2 SGB XI der Betrag zu zahlen, der von dem Leistungsträger als Beitrag bei Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung zu zahlen wäre, höchstens jedoch der Betrag, der an das private Versicherungsunternehmen zu zahlen ist.
7 Rentner
7.1 Voraussetzungen für die Gewährung des Beitragszuschusses
Rentenbezieher, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert oder nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch verpflichtet sind, bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen einen Versicherungsvertrag zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit abzuschließen und aufrechtzuerhalten, erhalten zu ihrer Rente einen Zuschuß zu den Aufwendungen für die Pflegeversicherung.
Der Zuschuß des Rentenversicherungsträgers setzt einen fristgerechten Antrag voraus; ausgenommen sind Bestandsrenten.
7.2 Höhe des Beitragszuschusses
Der monatliche Beitragszuschuß wird nach § 106 a Abs. 2 SGB VI in Höhe des Beitrags geleistet, den der Träger der Rentenversicherung als Pflegeversicherungsbeitrag für Rentenbezieher zu tragen hat, die in der sozialen Pflegeversicherung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 SGB XI verpflichtet sind. Eine Begrenzung des Zuschusses auf die Hälfte der tatsächlichen Aufwendungen für die Pflegeversicherung ist aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht vorgesehen. Bei freiwillig krankenversicherten Rentenbeziehern, bei denen § 55 Abs. 1 Satz 2 SGB XI angewendet wird, vermindert sich der Beitragszuschuß auf die Hälfte des Beitragsanteils, den der Rentenversicherungsträger als Pflegeversicherungsbeitrag für Rentenbezieher zu tragen hat, die in der sozialen Pflegeversicherung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 SGB XI pflichtversichert sind. Gleiches gilt auch für privat versicherte Rentner, für die bei Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung § 55 Abs. 1 Satz 2 SGB XI Anwendung finden würde. In der Zeit vom 1. 1. 1995 bis 30. 6. 1996 wird der Zuschuß für diesen Personenkreis auf der Grundlage des Beitragssatzes nach § 55 Abs. 1 Satz 1 SGB XI berechnet, wenn bereits am 31. 12. 1994 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurde (vgl. Ausführungen unter F IV).
Bezieht ein Rentner mehrere Renten, kann der Zuschuß auch in einer Summe zu einer dieser Renten geleistet werden.
8 Rentenberechtigte Beschädigte
8.1 Voraussetzungen für die Beitragserstattung
Rentenberechtigte Beschädigte und Hinterbliebene, die einen Anspruch auf Heil- oder Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz oder
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 57 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
nach den Gesetzen haben, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, erhalten ihren Beitrag zu Pflegeversicherung nach § 53 a Abs. 1 BVG erstattet. Die Erstattung von Beiträgen setzt voraus, daß sie bei einem privaten Versicherungsunternehmen pflegeversichert sind (§ 23 SGB XI) oder einer Pflegekasse – aufgrund einer Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 3 SGB XI – als Mitglied angehören.
Damit wird im Ergebnis erreicht, daß diese Personen, die bisher einen kostenfreien Anspruch auf Pflegeleistungen (im Rahmen der Heil- oder Krankenbehandlung) hatten, auch für die Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung keine Beiträge zu entrichten brauchen.
Hinsichtlich der von den privaten Versicherungsunternehmen zu erfüllenden Voraussetzungen wird auf die Ausführungen unter 3.2 verwiesen.
8.2 Höhe der Beitragserstattung
Grundsätzlich werden die tatsächlichen Aufwendungen zur Pflegeversicherung erstattet. Die Beitragserstattung ist in der Höhe jedoch begrenzt auf den Betrag, der sich bei Zugrundelegung des Beitragssatzes nach § 55 Abs. 1 Satz 1 SGB XI und dem Zahlbetrag der Rentenleistung nach dem Bundesversorgungsgesetz ergibt (§ 53 a Abs. 2 BVG). Bei Beschädigten zählen als berücksichtigungsfähige Rentenleistungen allerdings nur die Leistungen, die zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zum Ausgleich des wirtschaftlichen Schadens dienen. Dazu gehören die Ausgleichsrente, der Ehegattenzuschlag und der Berufsschadensausgleich.
9 Schüler und Studenten
Für Schüler und Studenten, die in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig oder nach § 23 SGB XI verpflichtet sind, bei einem privaten Versicherungsunternehmen eine Pflegeversicherung abzuschließen, erhöht sich gemäß § 13 a BAföG der jeweilige Bedarfssatz nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für die Pflegeversicherung vom 1. 1. 1995 an um monatlich 10 Deutsche Mark, vom 1. 7. 1996 an um monatlich 15 Deutsche Mark.
Hinsichtlich der von den privaten Versicherungsunternehmen zu erfüllenden Voraussetzungen wird auf die Ausführungen unter 3.2 verwiesen.
10 Künstler und Publizisten
10.1 Voraussetzungen für die Gewährung und Höhe des Beitragszuschusses für freiwillig krankenversicherte Künstler und Publizisten
Nach § 10 a Abs. 1 KSVG erhalten selbständige Künstler und Publizisten, die sich nach § 7 KSVG von der Krankenversicherungspflicht haben befreien lassen (höherverdienende Künstler) und als Folge dieser Befreiung auch in der
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 58 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
sozialen Pflegeversicherung nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz versicherungfrei sind (vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 2 KSVG), auf Antrag einen Zuschuß zu ihrem Pflegeversicherungsbeitrag, wenn sie der sozialen Pflegeversicherung – über § 20 Abs. 3 SGB XI – als Mitglied angehören.
Als Zuschuß ist die Hälfte des Beitrags zu zahlen, der im Falle der Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB XI zu zahlen wäre. Höchstens erhält der Versicherte jedoch die Hälfte des Betrages, den er tatsächlich als Pflegeversicherungsbeitrag aufwendet. Bei der Berechnung des Zuschusses wird – wie für den Krankenversicherungsbeitragszuschuß – ein Mindestarbeitseinkommen nach § 234 Abs. 1 Satz 1 SGB V nicht in Ansatz gebracht, d. h. der Beitragszuschuß richtet sich auch dann nach dem erzielten Arbeitseinkommen, wenn dieses unterhalb des Mindestarbeitseinkommens liegt (§ 10 a Abs. 1 Satz 2 KSVG).
10.2 Voraussetzungen für die Gewährung und Höhe des Beitragszuschusses für privat krankenversicherte Künstler und Publizisten
Selbständige Künstler und Publizisten, die nach den §§ 6 und 7 KSVG von der Krankenversicherungspflicht befreit und gemäß § 23 SGB XI verpflichtet sind, einen privaten Pflegeversicherungsvertrag für sich und ihre Familienangehörigen abzuschließen, erhalten auf Antrag von der Künstlersozialkasse einen Zuschuß zu ihrem Pflegeversicherungsbeitrag (§ 10 a Abs. 2 KSVG).
Hinsichtlich der von den privaten Versicherungsunternehmen zu erfüllenden Voraussetzungen wird auf die Ausführungen unter 3.2 verwiesen.
Der Zuschuß beträgt die Hälfte des Beitrags, den die Künstlersozialkasse bei Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB XI an die Krankenkasse (zugunsten der Pflegekasse) zu zahlen hätte. Der Zuschuß ist jedoch begrenzt auf die Hälfte des Betrags, den der Künstler für seine private Pflegeversicherung tatsächlich zu zahlen hat, wie sich durch die Verweisung in § 10 a Abs. 2 Satz 3 KSVG auf § 10 Abs. 2 Satz 3 KSVG ergibt. Bei der Zuschußberechnung wird ein Mindestarbeitseinkommen nach § 234 Abs. 1 Satz 1 SGB V nicht in Ansatz gebracht. Wie bei den freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Künstlern wird zunächst nur ein vorläufiger Beitragszuschuß gewährt.
F Übergangsregelungen
I Befreiung von der Versicherungspflicht
1 Freiwillig krankenversicherte Mitglieder
1.1 Allgemeines
Neben der Möglichkeit der Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 22 SGB XI für Personen, die erst nach dem 1. 1. 1995 (Inkrafttreten des Ar-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 59 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
tikels 1 § 22 des Pflege-Versicherungsgesetzes) dem befreiungsberechtigten Personenkreis angehören, sieht Artikel 41 PflegeVG ein analoges Befreiungsrecht für diejenigen vor, die am 1. 1. 1995 bereits freiwillig krankenversichert sind.
1.2 Voraussetzungen der Befreiung
1.2.1 Gleichwertiger Versicherungsschutz
Aufgrund der Verweisung in Artikel 41 Abs. 1 Satz 3 PflegeVG auf § 22 Abs. 1 SGB XI gelten die Ausführungen unter A III 2.2.1 entsprechend.
1.2.2 Antragstellung
Der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach Artikel 41 Abs. 1 PflegeVG ist spätestens bis zum 30. 6. 1995 bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen. Diese Antragsfrist ist eine Ausschlußfrist.
Befreiungsanträge können allerdings bereits vor dem 1. 1. 1995 gestellt werden (Artikel 41 Abs. 1 Satz 2 PflegeVG).
1.3 Zuständige Pflegekasse
Zuständig für die Befreiung von der Versicherungspflicht ist die Pflegekasse, die bei der Krankenkasse errichtet ist, bei der die freiwillige Mitgliedschaft besteht.
1.4 Wirkung der Befreiung
Aufgrund der Verweisung in Artikel 41 Abs. 1 Satz 3 PflegeVG auf § 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB XI gelten die Ausführungen unter A III 2.4 entsprechend.
2 Personen mit „Alt“-Pflegeversicherungsverträgen
2.1 Allgemeines
Nach Artikel 42 PflegeVG können sich Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes (1. 1. 1995) bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert sind, von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach den §§ 20 und 21 SGB XI befreien lassen, wenn der Versicherungsvertrag vor dem 23. 6. 1993, dem Tag der Billigung des Gesetzentwurfs durch das Bundeskabinett, abgeschlossen wurde. Dieses Befreiungsrecht steht damit – im Gegensatz zu den Befreiungsregelungen des § 22 SGB XI sowie des Artikels 41 Abs. 1 PflegeVG – nicht nur den nach § 20 Abs. 3 SGB XI Versicherungspflichtigen (freiwillig krankenversicherten Mitgliedern), sondern auch den übrigen dem Grunde nach versicherungspflichtigen Mitgliedern der Pflegeversicherung zu.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 60 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
2.2 Voraussetzungen der Befreiung
2.2.1 Gleichwertiger Versicherungsschutz
Eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn der Vertrag mit dem privaten Versicherungsunternehmen Leistungen für den Befreiungsberechtigten sowie seine Angehörigen, für die nach § 25 SGB XI Anspruch auf Familienversicherung bestünde, vorsieht, die nach Art und Umfang den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung gleichwertig sind. Dem Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht kann allerdings auch dann entsprochen werden, wenn die Vertragsleistungen noch nicht dem Leistungsumfang der sozialen Pflegeversicherung entsprechen bzw. gleichwertig sind. In diesen Fällen besteht jedoch die Verpflichtung, den Vertrag spätestens bis zum 31. 12. 1995 dem Leistungsumfang der sozialen Pflegeversicherung anzupassen (Artikel 42 Abs. 1 Satz 3 PflegeVG).
Ansonsten wird hinsichtlich der Gleichwertigkeit des Versicherungsschutzes auf die Ausführungen unter A III 2.2.1 verwiesen.
2.2.2 Antragstellung
Der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach Artikel 42 PflegeVG ist spätestens bis zum 31. 3. 1995 zu stellen (Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 PflegeVG). Diese Antragsfrist ist eine Ausschlußfrist.
Befreiungsanträge können allerdings bereits vor dem 1. 1. 1995 gestellt werden.
2.3 Zuständige Pflegekasse
Der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht ist bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen. Bei Personen, die ohne die Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 20 SGB XI versicherungspflichtig wären, ist die Pflegekasse zuständig, die bei der Krankenkasse errichtet ist, bei der eine Mitgliedschaft besteht. Bei den Personen, die ohne die Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 21 SGB XI versichert wären, ist die Pflegekasse zuständig, die im Falle der Versicherungspflicht die Pflegeversicherung durchzuführen hätte (§ 48 Abs. 2 und 3 SGB XI).
2.4 Wirkung der Befreiung
Die Befreiung wirkt vom Beginn der Versicherungspflicht nach § 20 oder § 21 SGB XI an. Sie kann nicht widerrufen werden.
Die Befreiung gilt für die Dauer, für die – ohne die Befreiung – Versicherungspflicht nach § 20 oder § 21 SGB XI bestünde. Sie bleibt bei einer Veränderung inder Lebenssituation des einzelnen, an die wiederum die Versicherungspflicht oder eine Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung angeknüpft ist, ebenso wirksam wie in den Fällen, in denen im
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 61 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Anschluß an eine Versicherungspflicht nach § 23 SGB XI (während diser Zeit der Versicherungspflicht „ruht“ die Befreiung) ein dem Grunde nach pflegeversicherungspflichtiger Tatbestand eintritt.
2.5 Folgen der Nichtanpassung des Versicherungsvertrages
Wird der Pflegeversicherungsvertrag, der zum Zeitpunkt der Befreiung von der Versicherungspflicht nach Artikel 42 PflegeVG noch nicht gleichwertig war, entgegen der gesetzlichen Vorgabe nicht bis zum 31. 12. 1995 angepaßt oder wird der Vertrag nicht fortgesetzt, tritt vom 1. 1. 1996 an Versicherungspflicht nach § 20 oder § 21 SGB XI ein, sofern die Voraussetzungen für das Zustandekommen der Versicherungspflicht erfüllt sind (Artikel 42 Abs. 6 PflegeVG). In diesen Fällen erhält die Pflegekasse, die die Befreiung von der Versicherungspflicht ausgesprochen hat, über das Bundesversicherungsamt eine entsprechende Mitteilung. Dieser Mitteilung geht eine Meldung gemäß Artikel 42 Abs. 4 PflegeVG des privaten Versicherungsunternehmens an das Bundesversicherungsamt voraus.
2.6 Beitragszuschüsse
Die Beiträge für einen privaten Pflegeversicherungsvertrag werden auch in den Fällen bezuschußt, in denen sich der Versicherungsnehmer nach Artikel 42 PflegeVG von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung hat befreien lassen. Der Beitragszuschuß wird im Jahr 1995 selbst dann gewährt, wenn die Vertragsleistungen den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung noch nicht gleichwertig sind (Artikel 42 Abs. 5 Satz 2 PflegeVG).
2.7 Mitteilung an den Rentenversicherungsträger
Die Pflegekassen melden dem jeweiligen Rentenversicherungsträger die Personen, die sich von der Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 1 SGB XI aufgrund der Regelung des Artikels 42 PflegeVG haben befreien lassen, wenn sie am 1. 1. 1995 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, damit der Rentenversicherungsträger den Beitragseinbehalt vom Zeitpunkt der Wirkung der Befreiung an einstellen kann. Die Meldung erfolgt mit dem als Anlage 1 beigefügten Vordruck.
II Familienversicherung der Behinderten
Für Kinder, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten (behinderte Kinder), gilt für die Familienversicherung keine Altersgrenze (§ 25 Abs. 2 Nr. 4 SGB XI). Die Aufhebung der Altersgrenze setzt allerdings voraus, daß zu einem beliebigen Zeitpunkt nebeneinander die Behinderung und eine Familienversicherung als Kind vorgelegen haben muß.
Diese Voraussetzung kann von Behinderten, deren Behinderung bereits vor Inkrafttreten des Pflege-Versicherungsgesetzes eingetreten ist, nicht erfüllt
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 62 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
werden. Um diese Personen allerdings nicht auf Dauer von der Familienversicherung auszuschließen, werden die Behinderten aufgrund des Artikels 40 PflegeVG so behandelt, als hätte die Pflegeversicherung zum Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung bereits bestanden.
III Befristete Beitragsfreiheit für Pflegebedürftige
1 Allgemeines
Nach Artikel 47 PflegeVG besteht für Pflegebedürftige, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (1. 1. 1995) vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim erhalten, bis zum 30. 6. 1996 (Tag vor dem Inkrafttreten der Regelung des § 43 SGB XI) auf Antrag Beitragsfreiheit in der sozialen Pflegeversicherung. Durch diese Stichtagsregelung werden bestimmte Pflegebedürftige von der Beitragsleistung freigestellt, da davon auszugehen ist, daß sie vor dem 1. 7. 1996 grundsätzlich keine Leistungsansprüche gegen die Pflegekasse geltend machen können.
Als Pflegeheim kommen insbesondere Einrichtungen im Sinne des § 71 Abs. 2 SGB XI in Betracht. Die Zulassung der Einrichtung durch die Pflegekasse (§ 72 Abs. 1 Satz 1 SGB XI) ist in diesem Zusammenhang nicht erforderlich.
Das Erfordernis des gleichzeitigen Bezugs bestimmter Entschädigungsleistungen während der stationären Unterbringung wird – anders als nach § 56 Abs. 4 SGB XI – für die Beitragsfreiheit nach dieser Vorschrift nicht verlangt. Unerheblich ist ferner, ob der Pflegebedürftige die Kosten der stationären Pflegeleistungen voll oder nur zum Teil trägt oder ob ein Dritter diese Leistungen erbringt.
Beitragsfreiheit kommt jedoch dann nicht zustande, wenn das pflegebedürftige Mitglied Familienangehörige hat, für die eine Familienversicherung nach § 25 SGB XI besteht.
2 Antragstellung
Die Beitragsfreiheit kommt nur auf Antrag des Mitglieds zustande. Der Antrag kann formlos gestellt werden. Mit dem Antrag muß allerdings der Nachweis erbracht werden, daß das Mitglied vollständige Pflege in einem Pflegeheim erhält.
In erster Linie wird es sich bei den Personen, bei denen Beitragsfreiheit nach Artikel 47 PflegeVG in Betracht kommen kann, um Rentner handeln. Die Rentenversicherungsträger werden deshalb zum 1. 1. 1995 alle Rentner durch ein entsprechendes Merkblatt über die Regelung des Artikels 47 PflegeVG informieren.
3 Wirkung der Beitragsfreiheit
Die Beitragsfreiheit ist personenbezogen und wirkt sich daher auf alle dem Grunde nach beitragspflichtigen Einnahmen aus. Die Pflegekasse teilt, sofern
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 63 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
das Mitglied nicht selbst zahlungspflichtig ist, der zum Beitragsabzug verpflichteten Stelle mit, daß in der Zeit vom 1. 1. 1995 bis zum 30. 6. 1996 keine Beiträge einzubehalten und abzuführen sind. In Bestandsfällen (Rentenbezug am 31. 12. 1994) sollte diese Mitteilung an den Rentenversicherungsträger mit dem als Anlage 1 beigefügten Vordruck vorgenommen werden. Ist die zum Beitragseinbehalt verpflichtete Stelle nicht in der Lage, den Einbehalt einzustellen oder kann der Einbehalt von Beiträgen nur für die Zukunft unterbleiben, erstattet die Pflegekasse dem Mitglied die Beiträge; zu Unrecht gezahlte Beiträge aus Renten werden vom Rentenversicherungsträger erstattet. Eine Erstattung von Beiträgen kommt allerdings nur insoweit in Betracht, als die Beiträge noch nicht verjährt sind (vgl. § 27 Abs. 2 Satz 1 SGB IV). Darüber hinaus teilt die Pflegekasse dem Rentenversicherungsträger die am 1. 1. 1995 nach Artikel 47 PflegeVG beitragsfreien freiwillig krankenversicherten Rentner mit. Dazu sollte ebenfalls der als Anlage 1 beigefügte Vordruck verwendet werden.
IV Rentner, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben
1 Freiwillig krankenversicherte Rentner
Personen, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, steht der Zuschuß nach § 106 a SGB VI nur in halber Höhe zu (§ 106 a Abs. 2 Satz 1 SGB VI in Verb. mit § 55 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). In einer Übergangszeit bis zum 30. 6. 1996 wird der Zuschuß an Personen, die am 31. 12. 1994 bereits eine Rente beziehen, nach Artikel 48 Abs. 1 Satz 1 PflegeVG jedoch in voller Höhe gezahlt.
Die Pflegekassen ermitteln die bei ihnen freiwillig krankenversicherten Rentner, die am 31. 12. 1994 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen und nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, und melden sie mit dem als Anlage 1 beigefügten Vordruck bis zum 31. 1. 1996 an den zuständigen Rentenversicherungsträger (Artikel 48 Abs. 1 Satz 2 PflegeVG).
2 Krankenversicherungspflichtige Rentner
Bei Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind und nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, findet Artikel 48 Abs. 1 Satz 1 PflegeVG keine Anwendung; sie tragen vom 1. 1. 1995 an nur den halben Beitragsanteil zur Pflegeversicherung.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 64 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Damit der Rentenversicherungsträger möglichst frühzeitig einen zutreffenden Beitragseinbehalt vornehmen kann, sollten die Pflegekassen auch diese Rentner dem zuständigen Rentenversicherungsträger melden; hierzu dient der als Anlage 1 beigefügte Vordruck.
3 Information der Rentenversicherungsträger
Die Rentenversicherungsträger werden alle Rentner rechtzeitig zum 1. Januar 1995 über die Pflegeversicherung informieren und dabei auch darauf hinweisen, daß Personen mit Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen nur den halben Beitrag zahlen. Die betroffenen Rentner werden zugleich aufgefordert, sich umgehend mit der zuständigen Pflegekasse in Verbindung zu setzen.
G Soziale Sicherung der Pflegeperson
I Allgemeines
1 Zweck und Umfang der sozialen Sicherung
Um die Pflegebereitschaft im häuslichen Bereich zu fördern und den hohen Einsatz der Pflegeperson anzuerkennen, die wegen der Pflegetätigkeit oftmals auf eine eigene Berufstätigkeit ganz oder teilweise verzichten bzw. diese aufgeben müssen, wird die soziale Sicherung der Pflegepersonen – über die mit der Rentenreform 1992 getroffenen Maßnahmen hinaus – weiter verbessert (vgl. Bundestags-Drucksache 12/5262 S. 82).
So unterliegen Pflegepersonen unter bestimmten Voraussetzungen der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, wobei die Pflegekassen, die privaten Versicherungsunternehmen und die Festsetzungsstellen für die Beihilfe die Rentenversicherungsbeiträge unter Berücksichtigung des Umfangs der Pflegetätigkeit zu entrichten haben. Darüber hinaus werden die Pflegepersonen während der pflegerischen Tätigkeit in den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen. In der Arbeitslosenversicherung werden Hilfen vorgesehen, um die Rückkehr in das Erwerbsleben nach Beendigung der Pflegetätigkeit zu erleichtern.
Die Vorschrift des § 44 Abs. 1 SGB XI stellt in diesem Zusammenhang lediglich eine Einweisungsnorm dar, aus der zwar Hinweise entnehmbar sind, in welchen Bereichen des Sozialgesetzbuchs Vorschriften zur Verbesserung der sozialen Sicherung der Pflegepersonen eingefügt bzw. geändert wurden, aus der aber Leistungsansprüche konstitutiv nicht abgeleitet werden können.
2 Begriff der Pflegepersonen
2.1 Definition
Pflegepersonen sind nach der Definition des § 19 SGB XI Personen, die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 SGB XI regelmäßig
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 65 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen. Zu den Pflegepersonen in diesem Sinne gehören in erster Linie Familienangehörige, Verwandte, aber auch Nachbarn, Freunde und sonstige ehrenamtlche Helfer. Darüber hinaus können auch Berufstätige bzw. Selbständige Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI sein, wenn trotz der Berufstätigkeit bzw. selbständigen Tätigkeit eine angemessene Versorgung und Betreuung des Pflegebedürftigen sichergestellt wird. Eine Absicherung dieser Personen in der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt allerdings nur dann, wenn die parallel zur Pflege ausgeübte Erwerbstätigkeit 30 Stunden in der Woche nicht übersteigt; auf die Art der anderweitigen Erwerbstätigkeit kommt es dabei nicht an.
Jugendliche im freiwilligen sozialen Jahr und Zivildienstleistende, die eine Pflegetätigkeit ausüben, sind keine Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI. Ebenfalls nicht zu den Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI gehören die Pflegekräfte, die die Pflegetätigkeit nur deshalb ausüben, weil die eigentliche Pflegeperson z. B. wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder anderen Gründen an der Pflege gehindert ist. Gleiches gilt auch, wenn bei Aufnahme einer Pflegetätigkeit bereits feststeht, daß sie nur vorübergehend (nicht mehr als zwei Monate) ausgeübt wird. Nicht zu den Pflegepersonen gehören ferner Pflegekräfte,
- – die bei der Pflegekasse angestellt sind (§ 77 Abs. 2 SGB XI),
- – die bei ambulanten Pflegeeinrichtungen angestellt sind (§ 71 Abs. 1, § 72 SGB XI),
- – mit denen die Pflegekasse einen Vertrag nach § 77 Abs. 1 SGB XI abgeschlossen hat,
- – die nach § 2 Nr. 2 SGB VI versichrungspflichtig sind,
in dieser Pflegetätigkeit.
2.2 Nicht erwerbsmäßige Pflege
Bei der Pflegetätigkeit von Familienangehörigen, Verwandten, Freunden oder Nachbarn besteht die widerlegbare Vermutung, daß die Pflege – ungeachtet der Höhe der finanziellen Anerkennung, die die Pflegeperson von dem Pflegebedürftigen erhält – nicht erwerbsmäßig ausgeübt wird. Gleiches gilt für die Pflegetätigkeit sonstiger Personen, wenn die finanzielle Anerkennung, die die Pflegeperson für ihre Tätigkeit von dem Pflegebedürftigen erhält, das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im Sinne des § 37 SGB XI nicht übersteigt. Die Grenzwerte gelten auch in den Fällen nicht als überschritten, in denen der Pflegebedürftige zwar die Kombinationsleistung (§ 38 SGB XI) oder die Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI) gewählt hat, aber dennoch der Pflegeperson eine finanzielle Anerkennung gewährt, die dem vollen Umfang des Pflegegeldes (je nach Pflegestufe) entspricht.
Teilen sich mehrere Pflegepersonen die Pflege eines Pflegebedürftigen, ist bei der Prüfung, ob die Grenzwerte überschritten werden, das „dem Umfang
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 66 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im Sinne des § 37 SGB XI“ anteilig im Verhältnis zum Umfang der Pflegetätigkeit zu berücksichtigen.
Werden die Grenzwerte (je nach Pflegestufe des Pflegebedürftigen) überschritten, ist zu prüfen, ob die Pflegetätigkeit gleichwohl nicht erwerbsmäßig ausgeübt wird oder aber ein Beschäftigungsverhältnis oder eine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt.
Steht die Pflegeperson in einer vertraglichen oder sonstigen Beziehung zu einem Dritten (z. B. einem Unternehmen der freien Wohlfahrtspflege), liegt keine nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit vor.
2.3 Umfang der Pflegetätigkeit
Die soziale Absicherung kommt nur für solche Pflegepersonen in Betracht, die einen Pflegebedürftigen regelmäßig mindestens 14 Stunden in der Woche nicht erwerbsmäßig pflegen. Dabei muß die wöchentliche Mindeststundenzahl durch die Pflegetätigkeit für einen Pflegebedürftigen erreicht werden. Es genügt nicht, wenn die erforderliche Mindeststundenzahl durch Kumulation einzelner Pflegestunden bei verschiedenen Pflegebedürftigen erfüllt wird. Bei der Feststellung der Pflegestundenzahl wird in erster Linie die Arbeitszeit berücksichtigt, die auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung entfällt und auch für die Feststellung des Grades der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und 15 SGB XI maßgeblich ist. Zum Umfang der erforderlichen Pflegetätigkeit beinhaltet das Gutachten des MDK an die Pflegekasse entsprechende Anhaltswerte (vgl. Ziff. 5.8 der Pflegebedürftigkeits-Richtlinien). Darüber hinaus findet bei der Feststellung der Pflegestundenzahl auch die Zeit Berücksichtigung, die für ergänzende Pflege und Betreuung benötigt wird (z. B. die notwendige Beförderung bei teilstationärer Pflege, § 41 Abs. 1 SGB XI).
Teilen sich zwei oder mehrere Pflegepersonen die Pflege eines Pflegebedürftigen (z. B. wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit), besteht für jede Pflegeperson die Möglichkeit der sozialen Absicherung, sofern sie – jeweils für sich gesehen – die Pflegetätigkeit an regelmäßig mindestens 14 Stunden wöchentlich ausübt.
Beispiel 1
| Ein Schwerpflegebedürftiger (Pflegestufe II) | |
| wird zu Hause an insgesamt | 30 Std./Woche |
| – nicht erwerbsmäßig – gepflegt. | |
| Die Pflege wird durchgeführt von | |
| Person A | 10 Std./Woche |
| Person B | 20 Std./Woche |
Lediglich Person B ist Pflegeperson im Sinne des § 19 SGB XI. Person A kommt nicht als Pflegeperson in Betracht, da die Pflegetätigkeit nicht mindestens 14 Stunden wöchentlich umfaßt.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 67 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Beispiel 2
| Ein Schwerpflegebedürftiger (Pflegestufe II) | |
| wird zu Hause im wöchentlichen Wechsel von | |
| Person A | 14 Std./Woche |
| Person B | 14 Std./Woche |
| – nicht erwerbsmäßig – gepflegt. |
Rentenversicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI besteht weder für Person A noch für Person B, da die Pflegetätigkeit nicht regelmäßig im Sinne der Vorschriften über die Rentenversicherungspflicht der Pflegepersonen ausgeübt werden.
2.4 Häusliche Umgebung
Voraussetzung für die Anerkennung als Pflegeperson im Sinne des § 19 SGB XI ist ferner, daß die Pflegetätigkeit in häuslicher Umgebung durchgeführt wird. Hierbei ist es unerheblich, ob die Pflegetätigkeit im Haushalt des Pflegebedürftigen, im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt einer dritten Person erfolgt. Häusliche Umgebung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Pflegebedürftige in einem Altenwohnheim, Altenheim, einem Wohnheim für Behinderte oder einer vergleichbaren Behinderteneinrichtung wohnt.
II Rentenversicherung
1 Versicherungspflicht
1.1 Allgemeines
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI für Personen in der Zeit, in der sie einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 SGB XI nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen, wenn der Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pflegeversicherung hat. Die Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI und die damit verbundene beitragsrechtliche Verpflichtung der Pflegekasse stellen eine Leistung der Pflegeversicherung dar, die erstmals vom 1. April 1995 an erbracht werden kann. Die Pflegekassen haben die Pflegepersonen über die Leistungen der Pflegekassen, insbesondere über die soziale Absicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung zu unterrichten und zu beraten (§ 7 Abs. 2 SGB XI).
Für die Durchführung der Rentenversicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI bedarf es eines Antrags der Pflegeperson bei der zuständigen Pflegekasse (vgl. Bundestags-Drucksache 12/5262 S. 109, 116). Zuständig ist die Pflegekasse, gegen die der Pflegebedürftige (nicht die Pflegeperson) Ansprüche auf Leistungen geltend machen kann.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 68 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Die den Pflegepersonen durch das Rentenreformgesetz 1992 eröffneten Möglichkeiten, Berücksichtigungszeiten wegen Pflege zu erhalten (§ 57 Abs. 2 SGB VI), freiwillige Beiträge in Pflichtbeiträge umzuwandeln (§ 177 Abs. 1 SGB VI) oder zusätzliche Pflichtbeiträge zu zahlen (§ 177 Abs. 2 SGB VI), enden mit dem 31. 3. 1995. Die Rentenversicherungsträger werden die Pflegepersonen, die von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht haben, über den Wegfall dieser Regelung bis zum 31. 3. 1995, über die ab 1. 4. 1995 geltende Rechtslage sowie über die Notwendigkeit der Antragstellung bei der zuständigen Pflegekasse informieren.
1.2 Beginn der Versicherungspflicht
Die Rentenversicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI beginnt grundsätzlich mit dem Tag, an dem der Pflegebedürftige Leistungen nach dem Pflege-Versicherungsgesetz beantragt, frühestens jedoch von dem Zeitpunkt an, in dem die Voraussetzungen der Versicherungspflicht (vgl. Ausführungen unter 1.3) vorliegen. Wird der Antrag später als einen Monat nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit gestellt, so beginnt die Versicherungspflicht frühestens mit Beginn des Monats der Antragstellung (§ 33 Abs. 1 Satz 3 SGB XI).
Sofern die Pflegetätigkeit nicht beendet, sondern lediglich unterbrochen wird, ist kein neuer Antrag erforderlich.
1.3 Voraussetzungen der Versicherungspflicht
Die Versicherungspflicht kommt zustande, wenn die in § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Das sind:
- – Pflege eines Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 SGB XI,
- – Pflegeperson ist nicht erwerbsmäßig tätig (vgl. auch Ausführungen unter I 2.2),
- – Umfang der Pflegetätigkeit muß regelmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich ausmachen (vgl. auch Ausführungen unter I 2.3),
- – Pflege in häuslicher Umgebung (vgl. auch Ausführungen unter I 2.4),
- – Anspruch des Pflegebedürftigen auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pflegeversicherung; als Leistungen im vorgenannten Sinne kommen in erster Linie das Pflegegeld (§ 37 SGB XI), die Kombinationsleistung (§ 38 SGB XI) und die Tages- und Nachtpflege (§ 41 SGB XI) in Betracht. Die Rentenversicherungspflicht wird allerdings nicht generell dadurch ausgeschlossen, daß der Pflegebedürftige die Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI) wählt. Insbesondere bei Pflegebedürftigen der Stufe II oder der Stufe III kann – je nach Einzelfall – durchaus noch zusätzlicher Pflegebedarf in Form der nicht erwerbsmäßigen (ehrenamtlichen) Pflegetätigkeit vorhanden sein. In diesen Fällen dürfte das Gutachten des MDK an die Pflegekasse entsprechende Ausführungen enthalten.
Die letztgenannte Voraussetzung gilt auch dann als erfüllt, wenn aufgrund des Bezugs von Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit der Leistungsanspruch des Versicherten insoweit ruht (vgl. § 34 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI).
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 69 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Pflegepersonen, die für ihre Tätigkeit von dem Pflegebedürftigen ein Arbeitsentgelt erhalten, das das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im Sinne des § 37 SGB XI nicht übersteigt, gelten nach § 3 Satz 2 erster Halbsatz SGB VI generell als nicht erwerbsmäßig tätig; für sie tritt nach ausdrücklicher Bestimmung in § 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SGB VI insoweit keine Rentenversicherungspflicht nach § 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI ein.
1.4 Ende der Versicherungspflicht
Die Rentenversicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI endet, wenn eine der Voraussetzungen für die Versicherungspflicht (vgl. Ausführungen unter 1.3) entfällt. Dies gilt auch, wenn die nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit lediglich unterbrochen wird (z. B. wegen Erholungsurlaubs oder Krankheit der Pflegeperson oder Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege).
1.5 Ausschluß der Versicherungspflicht
Die Versicherungspficht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI schließt das Entstehen oder den Fortbestand von Rentenversicherungspflicht nach anderen Vorschriften nicht aus, so daß eine Mehrfachversicherung möglich ist. Dies gilt – wie sich aus dem Umkehrschluß des § 3 Satz 3 SGB VI ergibt – allerdings nur für die Pflegepersonen, die neben der Pflegetätigkeit regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich beschäftigt oder selbständig tätig sind.
2 Versicherungsfreiheit und Befreiung von der Versicherungspflicht
Rentenversicherungsfrei sind nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI Personen, die eine geringfügige nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit ausüben, wobei sich die Versicherungsfreiheit nur auf diese Pflegetätigkeit bezieht.
Eine nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit ist geringfügig, wenn die Beitragsbemessungsgrundlage für die Pflegetätigkeit (§ 166 Abs. 2 SGB VI) ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt (vgl. Ausführungen unter 4); mehrere nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeiten sind zusammenzurechnen (§ 5 Abs. 2 Satz 3 SGB VI). Eine Zusammenrechnung einer geringfügig nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit mit einer geringfügigen Beschäftigung oder geringfügigen selbständigen Tätigkeit erfolgt dagegen nicht. Die Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI dürfte in der Praxis allerdings keine Bedeutung erlangen.
Im übrigen sind nicht erwerbsmäßig tätig Pflegepersonen dann versicherungsfrei, wenn sie eine der „allgemeinen“ Voraussetzungen für die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung (vgl. § 5 Abs. 4 SG VI) erfüllen. Mithin werden Pflegepersonen nicht der Rentenversicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI unterstellt, wenn sie
- – eine Vollrente wegen Alters beziehen,
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 70 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
- – nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsständischen Versorgungseinrichtung eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze beziehen oder die in der Gemeinschaft übliche Versorgung im Alter nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VI erhalten oder
- – bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres nicht versichert waren oder nach Vollendung des 65. Lebensjahres eine Beitragserstattung aus ihrer Versicherung erhalten haben.
Dagegen unterliegen die nach § 6 SGB VI von der Rentenversicherungspflicht befreiten Personen aufgrund einer nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit der Rentenversicherungspflicht.
Selbständig Tätige, die am 31. 12. 1991 im Beitrittsgebiet aufgrund eines Versicherungsvertrages von der Rentenversicherungspflicht befreit waren, bleiben nach § 231 a Satz 1 SGB VI grundsätzlich in jeder Beschäftigung oder Tätigkeit von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreit. Diese Befreiung erstreckt sich allerdings nicht auf eine nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit. Das bedeutet, daß diese selbständig Tätigen Versicherungspflichtzeiten nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI erwerben können.
Gleiches gilt für Personen, die am 31. 12. 1991 als
- – Angestellte im Zusammenhang mit der Erhöhung oder dem Wegfall der Jahresarbeitsverdienstgrenze,
- – Handwerker oder
- – Empfänger von Versorgungsbezügen
von der Rentenversicherungspflicht befreit waren (§ 231 Satz 2 SGB VI), wenn sie eine nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit ausüben.
3 Rentenversicherungszuständigkeit
Für die nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI rentenversicherungspflichtigen nicht erwerbsmäßigen Pflegepersonen gilt die allgemeine Zuständigkeitsaufteilung in der Rentenversicherung.
Danach bleibt ein Rentenversicherungsträger für die Durchführung der Versicherung aufgrund einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit zuständig, solange nicht ein anderer Träger aufgrund einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit ausschließlich zuständig wird (§ 126 Abs. 1 Satz 1 in Verb. mit Satz 2 SGB VI). Dies bedeutet, daß für die nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen stets der Rentenversicherungsträger zuständig ist, bei dem die Pflegeperson
- – zuletzt versichert war oder
- – aufgrund einer neben der Pflegetätigkeit ausgeübten Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit derzeit versichert ist.
Sind vor Beginn der Pflegetätigkeit keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt worden, ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zuständig; auf Antrag ist der Träger der Rentenversicherung der Ar-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 71 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
beiter zuständig (§ 126 Abs. 3 SGB VI). Das Wahlrecht kann nur einmal ausgeübt werden.
Die Bundesknappschaft führt die Versicherung für Personen, die wegen einer nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit bei ihr versichert sind, in der Rentenversicherung der Arbeiter oder in der Rentenversicherung der Angestellten durch.
4 Beitragspflichtige Einnahmen
4.1 Allgemeines
Die beitragspflichtigen Einnahmen (Bemessungsgrundlage) bei Pflegepersonen, für die eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI begründet ist, werden nach § 166 Abs. 2 Satz 1 SGB VI entsprechend dem pflegerischen Aufwand bestimmt. Dabei wird nicht nur auf die jeweilige Stufe der Pflegebedürftigkeit abgestellt, sondern zusätzlich innerhalb der Stufen nach dem tatsächlichen zeitlichen Aufwand differenziert. Die unterschiedliche Bewertung desselben Zeitaufwandes in den verschiedenen Stufen rechtfertigt sich dadurch, daß die tatsächliche (körperliche und seelische) Belastung der Pflegeperson mit zunehmender Pflegebedürftigkeit steigt.
Die Bestimmung der beitragspflichtigen Einnahmen erfolgt – entsprechend dem pflegerischen Aufwand – in Vomhundertsätzen der Bezugsgröße. Wird die Pflegetätigkeit im Beitrittsgebiet ausgeübt, ist die Bezugsgröße (Ost) maßgebend (§ 228 a Abs. 1 SGB VI). Auf den Wohnort der Pflegeperson kommt es nicht an. Für Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege im Beitrittsgebiet treten Entgeltpunkte (Ost) an die Stelle der ermittelten Entgeltpunkte (§ 254 d Abs. 1 Nr. 4 a SGB VI).
Teilen sich mehrere Pflegepersonen die Pflegetätigkeit, werden die beitragspflichtigen Einnahmen entsprechend dem Umfang der einzelnen Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Umfang der Pflegetätigkeit insgesamt auf die Pflegepersonen verteilt (§ 166 Abs. 2 Satz 2 SGB VI).
4.2 Bemessungsgrundlage bei Pflege eines Schwerstpflegebedürftigen
Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Rentenversicherung bei Pflege eines Schwerstpflegebedürftigen i Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI ist
- – 80 v. H. der Bezugsgröße, wenn der Pflegebedürftige mindestens 28 Stunden in der Woche gepflegt wird (§ 166 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a SGB VI),
- – 60 v. H. der Bezugsgröße, wenn der Pflegebedürftige mindestens 21 Stunden in der Woche gepflegt wird (§ 166 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b SGB VI),
- – 40 v. H. der Bezugsgröße, wenn der Pflegebedürftige mindestens 14 Stunden in der Woche gepflegt wird (§ 166 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c SGB VI).
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 72 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
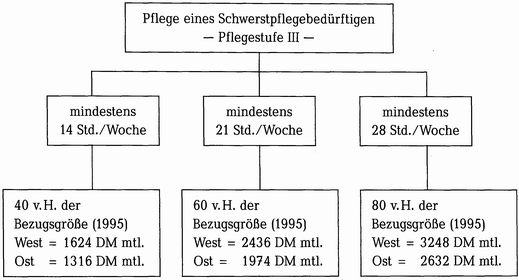
4.3 Bemessungsgrundlage bei Pflege eines Schwerpflegebedürftigen
Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Rentenversicherung bei Pflege eines Schwerpflegebedürftigen im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI ist
- – 53,3333 v. H. der Bezugsgröße, wenn der Pflegebedürftige mindestens 21 Stunden in der Woche gepflegt wird (§ 166 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a SGB VI),
- – 35,5555 v. H. der Bezugsgröße, wenn der Pflegebedürftige mindestens 14 Stunden in der Woche gepflegt wird (§ 166 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b SGB VI).
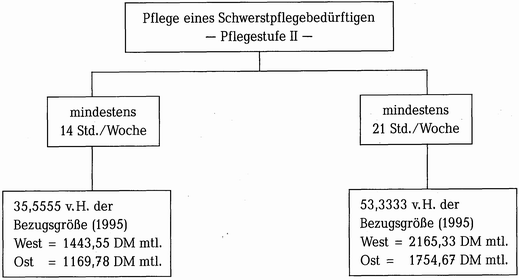
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 73 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
4.4 Bemessungsgrundlage bei Pflege eines erheblich Pflegebedürftigen
Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Rentenversicherung bei Pflege eines erheblich Pflegebedürftigen im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI ist 26,6667 v. H. der Bezugsgröße, wenn der Pflegebedürftige mindestens 14 Stunden in der Woche gepflegt wird (§ 166 Abs. 2 Nr. 3 SGB VI).
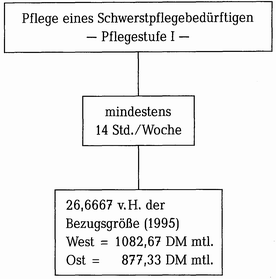
4.5 Mehrfachpflege eines Pflegebedürftigen
Üben mehrere nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus, sind beitragspflichtige Einnahmen bei jeder Pflegeperson der Teil des Höchstwertes der jeweiligen Pflegestufe, der dem Umfang ihrer Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Umfang der Pflegetätigkeit insgesamt entspricht (§ 166 Abs. 2 Satz 2 SGB VI). Die aufgrund des Gesamtpflegeaufwandes maßgeblichen beitragspflichtigen Einnahmen sind somit auf mehrere Pflegepersonen aufzuteilen (s. Beispiel 1). Personen, die unter 14 Stunden in der Woche pflegen und damit nicht der Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI unterliegen, sind in die Aufteilung allerdings nicht einzubeziehen. Die Beitragsbemessungsgrundlagen ergeben sich dann für die übrigen Personen aus dem Umfang der von ihnen insgesamt abgeleisteten Pflegetätigkeiten (s. Beispiel 3). In die Aufteilung einzubeziehen sind jedoch auch diejenigen, die lediglich dem Grunde nach versicherungspflichtig und z. B. wegen des Bezugs einer Vollrente wegen Alters nach § 5 Abs. 4 SGB VI versicherungsfrei sind (s. Beispiel 2).
Beispiel 1 (alte Bundesländer)
| Ein Schwerpflegebedürftiger (Pflegestufe II) | |
| wird zu Hause an insgesamt | 34 Std./Woche |
| – nicht erwerbsmäßig – gepflegt. |
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 74 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
| Die Pflege wird durchgeführt von | |
| Person A | 14 Std./Woche |
| Person B | 20 Std./Woche |
Der Pflegebedürftige wird an mindestens 21 Std./Woche (hier: 34 Std./Woche) gepflegt, so daß insgesamt als beitragspflichtige Einnahme 53,3333 v. H. der monatlichen Bezugsgröße zugrunde zu legen sind.
Beitragspflichtige Einnahmen
| Person A: | |
| 53,3333 v. H. der Bezugsgröße x 14 Std. | |
| 34 Std. |
Beitragspfichtige Einnahmen
| Person B: | |
| 53,3333 v. H. der Bezugsgröße x 20 Std. | |
| 34 Std. |
Beispiel 2 (alte Bundesländer)
| Ein Schwerpflegebedürftiger (Pflegstufe II) | |
| wird zu Hause an insgesamt | 34 Std./Woche |
| – nicht erwerbsmäßig – gepflegt. | |
| Die Pflege wird durchgeführt von Person A | |
| (Bezieher einer Vollrente wegen Alters) | 14 Std./Woche |
| Person B | 20 Std./Woche |
Der Pflegebedürftige wird an mindestens 21 Std./Woche (hier: 34 Std./Woche) gepflegt, so daß insgesamt als beitragspflichtige Einnahmen 53,3333 v. H. der monatlichen Bezugsgröße zugrunde zu legen sind.
Beitragspflichtige Einnahmen
| Person A | entfällt, da als Bezieher einer Vollrente wegen Alters rentenversicherungsfrei nach § 5 Abs. 4 SGB VI |
Beitragspflichtige Einnahmen
| Person B: | |
| 53,3333 v. H. der Bezugsgröße x 20 Std. | |
| 34 Std. |
Beispiel 3 (neue Bundesländer)
| Ein Schwerpflegebedürftiger (Pflegstufe II) | |
| wird zu Hause an insgesamt | 30 Std./Woche |
| – nicht erwerbsmäßig – gepflegt. | |
| Die Pflege wird durchgeführt von | |
| Person A | 10 Std./Woche |
| Person B | 20 Std./Woche |
Person A ist keine Pflegeperson im Sinne der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI, da der Umfang der Pflegetätigkeit nicht mindestens 14 Stunden in der Woche ausmacht. Infolgedessen reduziert sich der für die Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen maßgebende Gesamtumfang der Pflegetätig-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 75 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
keit von 30 Std./Woche auf 20 Std./Woche mit der Folge, daß für Pflegeperson B als beitragspflichtige Einnahmen 35,5555 v. H. der monatlichen Bezugsgröße (Ost) zugrunde zu legen sind, da Pflegeperson B den Pflegebedürftigen an mindestens 14 Std./Woche (hier: 20 Std./Woche) pflegt.
Beitragspflichtige Einnahmen
| Person A: | entfällt, da Pflegetätigkeit nicht mindestens 14 Std./Woche |
Beitragspflichtige Einnahmen
| Person B: | |
| 35,5555 v. H. der Bezugsgröße (Ost) x 20 Std. | |
| 20 Std. |
5 Beitragssatz
Die Rentenversicherungsbeiträge werden nach dem Beitragssatz berechnet, der in dem Zeitraum, in dem die Pflegetätigkeit ausgeübt wird, maßgebend ist.
6 Beitragstragung
Die Beiträge zur Rentenversicherung für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen werden ausschließlich von den (Pflege-)Leistungsträgern aufgebracht. Das sind
- – für Pflegepersonen, die einen in der sozialen Pflegeversicherung pflichtversicherten Pflegebedürftigen pflegen, die Pflegekassen (§ 170 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a SGB VI),
- – für Pflegepersonen, die einen bei einem privaten Versicherungsunternehmen Pflege-Pflichtversicherten pflegen, die privaten Versicherungsunternehmen (§ 170 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. b SB VI),
- – für Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen pflegen, der wegen Pflegebedürftigkeit Beihilfeleistungen und Leistungen eines privaten Versicherungsunternehmens erhält, die Festsetzungsstellen für die Beihilfe und die privaten Versicherungsunternehmen anteilig (§ 170 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. c SGB VI).
§ 170 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. c SGB VI gilt sinngemäß, wenn die Pflegeperson einen Pflegebedürftigen pflegt, der bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe und auf (halbe) Leistungen der sozialen Pflegeversicherung (vgl. § 28 Abs. 2 SGB XI) hat.
7 Beitragsfälligkeit, Beitragszahlung und Beitragsabrechnung
Die Rentenversicherungsbeiträge der Pflegepersonen werden nach § 23 SGB IV spätestens am Fünfzehnten des Monats fällig, der dem Monat folgt, in dem die Pflegetätigkeit ausgeübt wurde. Sie sind entsprechend dem Grund-
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 76 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
satz des § 173 SGB VI von denjenigen, die sie zu tragen haben, unmittelbar an die Träger der Rentenversicherung zu zahlen.
Die Beiträge werden den Rentenversicherungsträgern in der Monatsberechnung Teil B Pos. 6.4 (Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen) nachgewiesen.
Der Bundesknappschaft sind als Träger der knappschaftichen Rentenversicherung keine Beiträge zu überweisen, da die Bundesknappschaft die Versicherung der Pflegepersonen in der Rentenversicherung der Arbeiter oder der Rentenversicherung der Angestellten durchführt; die entsprechenden Beiträge sind an die örtliche Landesversicherungsanstalt bzw. an die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zu zahlen.
8 Meldeverfahren
8.1 Allgemeines
Die Pflegekasse hat die in der Rentenversicherung zu versichernde Pflegeperson dem zuständigen Rentenversicherungsträger zu melden (§ 44 Abs. 2 Satz 1 SGB XI). Näheres über das Meldeverfahren können die Spitzenverbände der Pflegekassen mit dem Verband Deutscher Rentenversicherungsträger durch Vereinbarung regeln. Die Vorschrift des § 44 Abs. 2 Satz 3 SGB XI sieht eine entsprechende Ermächtigung vor.
8.2 Inhalt der Meldung
Die Meldung für die Pflegeperson hat gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 SGB XI zu enthalten:
- 1. Versicherungsnummer, soweit bekannt,
- 2. Familien- und Vornamen,
- 3. Geburtsdatum,
- 4. Staatsangehörigkeit,
- 5. Anschrift,
- 6. Beginn und Ende der Pflegetätigkeit,
- 7. die Pflegestufe des Pflegebedürftigen und
- 8. die unter Berücksichtigung des Umfangs der Pflegetätigkeit nach § 166 SGB VI maßgeblichen beitragspflichtigen Einnahmen.
Der Inhalt der Meldung ist mit Ausnahme der Angabe zu Nummer 7 der Pflegeperson schriftlich mitzuteilen. Der Inhalt der Meldung nach Nummer 7 ist dem Pflegebedürftigen mitzuteilen (§ 44 Abs. 3 SGB XI).
8.3 Meldetatbestände und Meldefristen
Die Pflegekasse meldet dem zuständigen Rentenversicherungsträger Beginn (Anmeldung) und Ende (Abmeldung) der Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI; hierfür gelten die Meldefristen der 2. DEVO/2. DÜVO entsprechend.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 77 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Gleiches gilt grundsätzlich bei einer Unterbrechung der Pflegetätigkeit, da diese wiederum das Ende der Versicherungspficht nach sich zieht (vgl. Ausführungen unter 1.4). Wird die Pflegetätigkeit jedoch weniger als einen vollen Kalendermonat unterbrochen, kann auf die Erstattung der Abmeldung verzichtet werden. Bei einer Unterbrechung von mindestens einem vollen Kalendermonat ist eine Abmeldung (Grund der Abgabe = 2) zu erstatten.
Dauert die Versicherungspflicht über das Ende eines Kalenderjahres hinaus an, ist bis zum 31. 3. des Jahres für jede am 31. 12. des Vorjahres tätige Pflegeperson eine Jahresmeldung zu erstatten.
Zusätzlich hat die Pflegekasse, die Zeiten der Rentenversicherungpflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI gemeldet hat, diese Zeiten unverzüglich zu berichtigen bzw. zu stornieren, wenn die Meldung unzutreffende, plausible Daten enthalten haben. Als unplausibel von der Datenstelle der Rentenversicherungsträger bzw. der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zurückgewiesene, fehlerhafte Datensätze sind nach ihrer Berichtigung erneut zu übermitteln.
8.4 Form der Meldung
8.4.1 Allgemeines
Für die Meldung der nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI versicherten Pflegepersonen wird das DÜVO-Verfahren zugrunde gelegt (vgl. Anlage 3). Je nach Versicherungszugehörigkeit ist die Datenstelle der Rentenversicherungsträger bzw. die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte Annahmestelle für die Datensätze. Wenn eine Pflegeperson mehrere Pflegebedürftige pflegt, sind auch mehrere Meldungen zu erstatten.
8.4.2 Ermittlung der Versicherungsnummer
Soweit der Pflegekasse die Versicherungsnummer der Pflegeperson nicht bekannt ist, wird diese mit dem Datensatz über den Antrag auf Vergabe einer Versicherungsnummer (Satzkennzeichen – SK 53) über die Datenstelle der Rentenversicherungsträger bzw. die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte beantragt. Für Pflegepersonen sind nur Sozialversicherungsausweise auszustellen. Daher ist das Feld MMSH im Datensatz SK 53 mit 6 zu beschicken. Die Bedeutung der Verschlüsselung 6 (geringfügig Beschäftigte) wird auf die Pflegeperson ausgedehnt.
8.4.3 Anmeldung
Der Beginn der Versicherung als Pflegeperson wird mit der Anmeldedatensatzkombination SK 00, 11 und 13 der Rentenversicherung angezeigt. Die Kennzeichnung der Pflegeperson erfolgt im Feld TT im Datensatz SK 00. Das Feld TT hat dabei folgende Bedeutung:
88880 = Pflegeperson (West)
88881 = Pflegeperson (Ost)
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 78 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
88882 = Pflegeperson (West) und Beihilfe
88883 = Pflegeperson (Ost) und Beihilfe
Das Feld BYGR im Datensatz SK 00 enthält für Pflegepersonen die Verschlüsselung 010 bzw. 020.
8.4.4 Abmeldung/Jahresmeldung
Abmeldungen bzw. Jahresmeldungen werden mit Datensatz SK 20 übermittelt. Die Felder TT und BYGR werden entsprechend Datensatz SK 00 beschickt.
Das Feld EG enthält die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen nach § 166 Abs. 2 SGB VI. Das gilt auch, wenn die Pflegekasse den Beitrag nur anteilig trägt.
8.4.5 Stornierung/Berichtigung
Stornierungen werden im Datensatz SK 33 angezeigt.
Bei Berichtigungen ist die Zeit mit einem Datensatz SK 33 zu stornieren und anschließend ein neuer Datensatz SK 20 zu liefern.
8.4.6 Bundesanstalt für Arbeit
Die Datensätze für Pflegepersonen werden nicht an die Bundesanstalt für Arbeit weitergeleitet.
III Unfallversicherung
1 Versicherter Personenkreis
Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI sind bei der Pflege eines Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 SGB XI nach § 539 Abs. 1 Nr. 19 RVO gegen Arbeitsunfall versichert, soweit die Pflegeperson in der Pflegetätigkeit nicht bereits zu den nach § 539 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 7 oder 13 RVO Versicherten gehören; die versicherte Tätigkeit umfaßt Pflegetätigkeiten im Bereich der Körperpflege und – soweit diese Tätigkeiten überwiegend Pflegebedürftigen zugute kommen – Pflegetätigkeiten in den Bereichen der Ernährung, der Mobilität sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung (§ 14 Abs. 4 SGB XI). Voraussetzungen für den Versicherungsschutz in der Unfallversicherung sind also, daß die Pflegetätigkeit nicht erwerbsmäßig, in häuslicher Umgebung des Pflegebedürftigen sowie in einem Umfang von mindestens 14 Stunden wöchentlich erbracht wird.
Ein bereits bestehender Unfallversicherungsschutz, z. B. für Beschäftigte im Sinne des § 539 Abs. 1 Nr. 1 RVO, für in landwirtschaftlichen Haushaltungen, im Gesundheitsdienst oder in der Wohlfahrtpflege sowie für ehrenamtlich Tätige im öffentlichen Bereich, geht im übrigen der Versicherung nach § 539 Abs. 1 Nr. 19 RVO vor.
| © ESV – SGB XI C 461 Seite 79 – SGB XI, 4. Lfg. III/96 |
Durch die Änderung des § 541 Abs. 1 Nr. 5 RVO wird sichergestellt, daß Versicherungsfreiheit bei Pflegetätigkeiten im Sinne des § 539 Abs. 1 Nr. 19 RVO nicht greift, wenn diese von Personen ausgeübt werden, die zu der pflegebedürftigen Personen in einem engen verwandtschaftlichen Verhältnis stehen.
2 Zuständiger Unfallversicherungsträger
Zuständig für die Versicherung des Personenkreises der Pflegepersonen nach § 539 Abs. 1 Nr. 19 RVO sind die Gemeinden und Gemeindeunfallversicherungsverbände (§ 657 Abs. 1 Nr. 10 RVO).
3 Beiträge
Die Gemeinden und Gemeindeunfallversicherungsverbände dürfen in den Fällen des § 657 Abs. 1 Nr. 10 RVO Beiträge von den Unternehmern nicht erheben (§ 770 Satz 5 RVO).
4 Meldeverfahren
Die Pflegekasse hat die in der Unfallversicherung zu versichernde Pflegeperson dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden (§ 44 Abs. 2 Satz 1 SGB XI).
Näheres über das Meldeverfahren können die Spitzenverbände der Pflegekassen mit den Trägern der Unfallversicherung durch Vereinbarung regeln.
1 Dieses Rundschreiben aus dem Jahr 1994 ist als Übersicht zu der Problematik weiterhin von Interesse. Zahlreiche Neuregelungen im Einzelnen sind seither in den KV Rundschreiben veröffentlicht worden, z. B. in der Zeitschrift „Die Leistungen“.
| © ESV |
